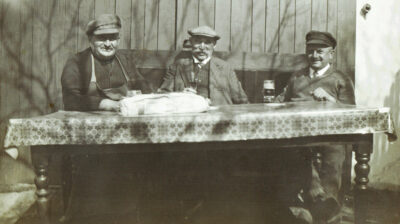Lebendig, kritisch, abwechslungsreich
Vor 35 Jahren, erschien im Mai 1990 erstmals das kulturelle Monatsheft „Vorschau und Rückblick“. Herausgeber war die Radebeuler Bürgerinitiative Kultur, eine mehr oder weniger zufällig zusammengewürfelte kulturaffine lose Truppe von Enthusiasten, die nach 26-jähriger Pause die Radebeuler Monatszeitschrift „Vorschau“ wiederbeleben wollte.
Von der vagen Idee, welche im November 1989 auf einer Bürgerversammlung in der Friedenskirche öffentlich geäußert wurde, über die Erteilung der Druck-Lizenz im Februar 1990 bis zum Erscheinen des ersten Heftes im Mai, waren viele Hürden zu nehmen.
Voller Zuversicht, getragen von der Aufbruchstimmung in gesellschaftlicher Umbruchzeit, hatten sich eine Bühnen- und Kostümbildnerin, eine Galeristin, eine Museumsassistentin, ein Kulturcafèbetreiber, ein Museumsleiter, ein Dipl.-Ing. Architekt und ein Schauspieler auf dieses wagemutige Unterfangen eingelassen. Allerdings ohne den Journalisten Dieter Malschewski, der sich bereiterklärte, die Redaktionsleitung zu übernehmen, hätte das alles wohl nicht funktioniert. Er verfügte als einziger über die Erfahrung, wie man eine Zeitschrift gestaltet, hatte er doch schon als junger Redakteur in der früheren „Vorschau“ mitgearbeitet. Die Titelseite entwarf der Radebeuler Maler und Grafiker Günter Schmitz und die Titelbildzeichnungen für den ersten Jahrgang stammten vom Architekten Thilo Hänsel.
Im Vorwort schrieb Ulrike Kunze im Namen des Redaktionskollegiums „Wir wollen die Eigenheiten, Schönheiten und Probleme beschreiben, mit denen unsere Stadt locken und schrecken kann. Und wir wollen sie informieren über das hoffentlich immer reicher werdende Kulturangebot…“.
Auch der damalige Bürgermeister Dr. Volkmar Kunze gratulierte: „Mit diesem Heft liegt die „Nummer 1“ vor, zu der ich namens der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverwaltung herzliche Grüße und Glückwünsche übermitteln möchte und den Wunsch zum Ausdruck bringe, dass ein immerwährendes Erscheinen gesichert wird. Die Stadtverwaltung dankt dem Redaktionskollegium und versichert, stets und ständig unterstützend zu wirken. Zugleich wünschen wir der „Vorschau und Rückblick“ breite interessierte Leserkreise“.
Von der Stadtverwaltung gab es ein großzügiges Startkapital, doch das war schneller aufgebraucht als gedacht und so wuchs Monat um Monat der Schuldenberg. Die Utopie von der neuen Freiheit besaß einen Webfehler, sie wurde ohne die Zwänge der Marktwirtschaft geträumt.
Dass es stabiler Strukturen bedurfte, war allen recht schnell klar und so erfolgte im November 1991 die Gründung des Vereins Radebeuler Monatsheft e.V. „Vorschau & Rückblick“. Zum Vorsitzenden wurde Dietrich Lohse gewählt. Im Jahr 2002 übernahm Ilona Rau diese Funktion, welche sie bis heute innehat. Zum 30-jährigen Jubiläum im Jahr 2020 wurden einmal alle bis dahin für die Vorschau tätigen Akteure in der Mai-Ausgabe auf einer Doppelseite mit Porträtfoto und Funktionsbezeichnungen vorgestellt. Seitdem sind wiederum fünf Jahre vergangen. Auch die „Jugendredaktion“ hat nunmehr die 50 überschritten. Und man fragt sich besorgt, wo bleiben die Vertreter der Generationen Y und Z? Ja, selbst schreibfreudige Neurentner scheinen Mangelware zu sein.
Schon das erste kulturelle Monatsheft beinhaltete eine große Themenvielfalt, darunter Beiträge über Altkötzschenbroda, die Partnerstadt St. Ingbert, Natur- und Landschaftsschutz, die Malerin Gussy Hippold, die Puppentheatersammlung, das Karl-May-Museum, das Bilzbad und auch über die „Radebeuler Kino(un)kultur“. Sogar eine Glosse findet sich im ersten Heft, deren Verfasser ganz Inkognito zunächst mit „W. Z“., später mit „Wozi“ und ab 2018 mit „Motzi“ unterzeichnet. Angekündigt wurden ein Vortrag zur Geschichte Kötzschenbrodas mit anschließender Diskussion über dessen Perspektive sowie das erste Radebeuler Kurzfilmfestival im Café Poltorgeist, dem späteren Café Color. Veröffentlicht wurde auch eine Übersicht aller Radebeuler Kultureinrichtungen, von denen der überwiegende Teil schon lange nicht mehr existiert.
Unzählige Veranstaltungstipps sowie Ausstellungs-, Theater-, Film- und Musikrezensionen folgten. Und immer wieder trugen interessante Leserbeiträge wesentlich zur inhaltlichen Bereicherung des Heftes bei. Regelmäßig und unentgeltlich veröffentlichten u. a. die Stadtarchivarin und Heimatforscherin Liselotte Schließer, die Schriftstellerin Tine Schulze-Gerlach, der Literatur- und Kunstwissenschaftler Prof. Manfred Altner, der Vermessungsingenieur und Autor Thomas Gerlach themenspezifische Einzelbeiträge und Fortsetzungsserien.
Aber auch die Texte des Radebeuler Autorenkreises „Schreibende Senioren“, die Schreibwerkstatt für Schüler oder die Serie „Als die Läden noch Namen von Leuten trugen“ stießen auf große Resonanz.
Zum 25-jährigen Jubiläum gratulierte Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche auf eine sehr warmherzige emotionale Weise: „Wer die „Vorschau und Rückblick“-Hefte gesammelt hat, besitzt einen gut recherchierten Schatz an wissens- und bemerkenswerten Beiträgen über die Stadt Radebeul und deren Umgebung. Das inhaltliche Spektrum ist breit gefächert und behandelt Themen der Stadtgeschichte, Denkmalpflege, Botanik, Kunst und Kultur sowie des Vereinslebens und der Alltagskritik. Vermittelt werden nicht nur Sachinformationen, sondern auch Gefühle wie Geborgenheit und Zugehörigkeit. Und damit leistet diese heimatverbundene Publikation einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur lokalen und regionalen Identifikation.
Ich wünsche dem Redaktionskollegium weiterhin reichlich Inspiration und „flinke Federn“ und freue mich in jedem Monat immer wieder neu auf „Vorschau und Rückblick“.
Doch nicht jeder Beitrag löste bei allen Lesern Freude aus. Offensichtlich neigen einige Redaktionsmitglieder zur widerständig-subtil-ironischen Polemik. Aber gerade das ist es, was unserem Heft die Würze verleiht. Und auf den monatlichen Redaktionssitzungen geht es mitunter etwas turbulenter zu, als im nachfolgenden Idealfall beschrieben wird: Jeweils am 1. Donnerstag im Monat trifft sich das Redaktionskollegium bei Wasser und Wein. Das druckfrische Heft wird mehr oder wenige kritisch ausgewertet, danach schweift der erwartungsfroh fragende Blick des Chefredakteurs Sascha Graedtke in die Runde: Wer schreibt diesmal und worüber? Danach werden die zugesandten Beiträge vorgestellt und eine Auswahl getroffen. Es folgt allgemein Organisatorisches und hin und wieder wird auch mal etwas Persönliches ausgetauscht. Das Kunststück für den leitenden Redakteur und die Layouterin besteht darin, alles Material auf 32 Seiten unterzubringen. Dabei hat die Platzierung der Anzeigen Priorität, bilden sie doch die finanzielle Basis für das Druckerzeugnis.
Obwohl sich das Outfit von „Vorschau & Rückblick“ mehrfach verändert hat, wurde das Schulheftformat und der schwarz/weiß-Druck bis heute ganz bewusst beibehalten.
Erhältlich ist das Monatsheft in Radebeuler Museen, Galerien, Bibliotheken, Buchhandlungen sowie in weiteren Läden und öffentlich zugängigen Einrichtungen. Auf der Website gibt es eine Übersicht. Vorm Kunsthaus Kötzschenbroda befindet sich die 24-Stunden-Kulturkapsel, in der das aktuelle Heft bis Monatsende vorrätig ist. Auslagestellen befinden sich auch in Moritzburg, Coswig, Weinböhla, Cossebaude und Radeburg.
Es lohnt sich durchaus, einmal in den alten Heften zu stöbern – sowohl print als digital. Die kompletten Jahrgänge von der „Vorschau“ und von „Vorschau & Rückblick“ sind im Radebeuler Stadtarchiv hinterlegt und einsehbar. Darüber hinaus hat unsere Online-Redaktion damit begonnen, ältere Beiträge aufzubereiten und ins Netz zu stellen.
Wenngleich die monatlich erscheinende “Vorschau“ nur von 1954 bis 1963, also gerade einmal neun Jahre existierte, wurde sie zu einem begehrten Sammlerobjekt, quasi zu einem Mythos mit Kult-Status. Es ist schon ein wenig paradox, dass die einstige „Vorschau“ aus heutiger Sicht zur „Rückschau“ wurde und deren Nachfolgerin zu „Vorschau und Rückblick“.
Erfreulich wäre es, wenn es uns gelänge, ein stärkeres Interesse für unser kulturelles Monatsheft bei den Neu-Radebeulern und jungen Menschen zu wecken. Die Digitalisierung bietet eine gute Möglichkeit, um den Austausch zwischen Autoren und Lesern zu befördern, was leider noch zu wenig genutzt wird. Eine rege Kommunikation findet hingegen zum Radebeuler Grafikmarkt statt, auf dem die Redaktion mit einem eigenen Stand vertreten ist.
Mit der wechselvollen Entwicklungsgeschichte unsere Monatszeitschrift hatte sich im Jahr 2020 die Abiturientin Hanna Kazmirowski im Rahmen einer schulischen Abschlussarbeit auseinandergesetzt. Ihre umfassende und sehr gewissenhaft recherchierte „Dokumentation über eine Radebeuler Monatszeitschrift im Kontext gesellschaftlicher Umbrüche zwischen 1954 – 1963 und 1989 – 1993“ ist sehr aufschlussreich und empfehlenswert. Die komplexe Publikation steht im Netz und ist online abrufbar.
Übrigens gratulierte neulich eine treue Leserin zum 35-jährigen Jubiläum und meinte lachend „Bewahrt Euch den Blick über die Elbe, die Weinberge und den Tellerrand!“ Na klar, dass versprechen wir doch gern. Allerdings, und das ist der Wermutstropfen, bedarf unser Redaktionskollegium spätestens bis zum 40-jährigen Jubiläum einer dringenden Verjüngungskur.
Karin (Gerhardt) Baum