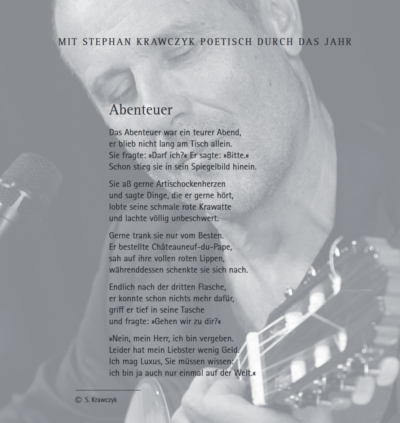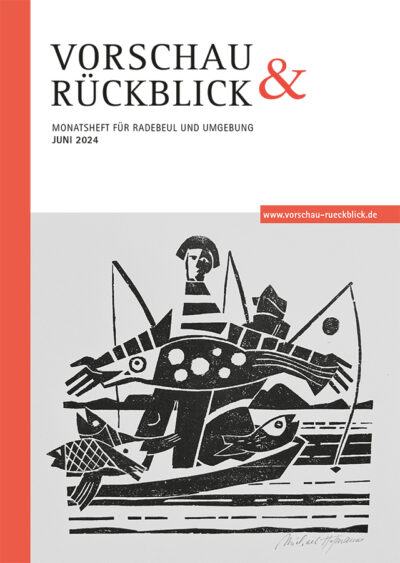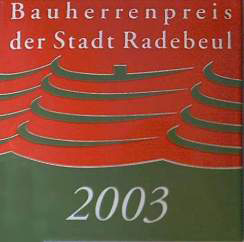Das Haus wolle »immer mehr ein Sammelpunkt aller heimatlichen Werte sein und wieder ein Kulturmittelpunkt der Lößnitz werden, wenn auch im neuzeitlichen Sinne.« So heißt es im »Kleinen Führer durch das Heimathaus Hoflößnitz«, der zur Saison 1925 erschien und fortan an alle Besuchenden als Eintrittskarte ausgegeben wurde. Nach einer Zusammenfassung der Geschichte des Anwesens folgte darin, stichpunktartig zusammengefasst,
Ein »Rundgang durch das Heimathaus«
Dieser war seinerzeit recht kurz, denn vom ohnehin nicht großen Erdgeschoss waren zweieinhalb Zimmer – ein Teil des Foyers, der »Zehrgarten« und die »große Tafelstube« auf der Ostseite – als Hausmannswohnung abgeteilt worden. Die vier Museumsräume boten folgendes:
»1. Eingangshalle: Der Winzerzug aus dem Jahre 1840 gez. von Retzsch; dargestellt: Der Herbst, Gott Baccus, Amor, Herstellung der Weinfässer, Weinbereitung. – Über der Tür ein Bildnis Knolls, des ›ersten Winzers‹, war 1661 Bau- und Bergschreiber in der Hoflößnitz, wirkte tatkräftig für Verbesserung des Weinbaues. – Ein großes Ölgemälde: Die Huldigung des Hauses Wettin. – In dem Wandschrank das Heldengedenkbuch, gewidmet den im Weltkrieg 1914/18 gefallenen Söhnen der Gemeinde Oberlößnitz.
2. Guckkastenzimmer: Vier naturgetreue Bilder, die vier Jahreszeiten darstellend (Rundgang rechts herum!) – Der Frühling: Die Lößnitz um 1800. Das Spitzhaus in der alten Gestalt, links das Bennoschlößchen, wahrscheinlich früher ein bischöflicher Wirtschaftshof, Winzer bei ihrer Arbeit. – Der Sommer: Die Lößnitz um 1800 [recte: 1900]. Spitzhaus nach dem Umbau. Der Wald ist heute bereits zum größten Teil wieder dem Wein gewichen. – Der Herbst: Winzerfest zur Zeit Augusts des Starken. Vorn Gebäude des unteren oder Holzhofes. – Der Winter: Aufbruch zur Jagd.
3. Geologisches Zimmer: Eine farbige, erdgeschichtliche, erhabene Karte der Heimat, in zwei Schaukästen die Gesteine der heimatlichen Erde, an der Wand zwei Geländeschnitte aus der, Umgebung u.a.m.
4. Heimatzimmer: Alte Bilder aus der Lößnitz. Holztafel mit Aufzeichnungen über den in der Hoflößnitz gepreßten Wein. Nachtwächterhorn von Oberlößnitz. Bildnisse der Gräfin Cosel und eines Regimentsnarren u.a.m.«
Um das eingangs zitierte Ziel zu erreichen, bedurfte es freilich mehr als dieser kleinen Präsentation. Das war auch dem Architekten Dr.-Ing. Alfred Tischer, ehrenamtlicher Museumsvorstand, klar. Schon kurz nach Eröffnung des Museums lancierte er deshalb ein zweites ehrgeiziges Projekt, ein großes »Winzerfest der Lößnitz«. Nachdem der von ihm geleitete Arbeitsausschuss am 1. August erstmals zusammengetreten war, ging dieses Volksfest, an dem sich fast 100 einheimische Vereine aller Art und Richtungen beteiligten, vom 3. bis 5. Oktober 1924 glanzvoll über die Bühne. Den Höhepunkt bildete am Schlusstag ein gewaltiger Festzug, der von der Hoflößnitz über Radebeul nach Kötzschenbroda führte und, was Teilnehmer- und Zuschauerzahlen angeht, sein historisches Vorbild von 1840 bei weitem in den Schatten stellte. Darauf wird zu gegebener Zeit zurückzukommen sein.
Die erste Sonderausstellung im neuen Museum Hoflößnitz ging ebenfalls auf Dr. Tischers Initiative zurück und eröffnete eine Tradition, der sich unser Haus nach wie vor verbunden fühlt, die Förderung der zeitgenössischen bildenden Kunst. Vom 7. bis 14. Dezember 1924 lud das Heimathaus zur »Kunstwoche der Lößnitz« ein, während derer »den gerade in dieser schweren Zeit oft bittere Not leidenden heimischen Künstlern« die Möglichkeit gegeben wurde, ihre Arbeiten – Erzeugnisse der Bildhauerei, Malerei, der graphischen Künste, des Kunstgewerbes, der Buchdruckerkunst usw. – zu zeigen und gegebenenfalls auch zu verkaufen. Über die Annahme der Ausstellungsgegenstände entschied ein Fachgremium, dem u.a. Landeskonservator Dr. Walter Bachmann, der ehemalige Direktor der Dresdner Kunstgewerbeakademie, Prof. Bernhard Grohberger, und der am selben Institut tätige Prof. Max Frey angehörten. Die Besprechung in den ›Dresdner Nachrichten‹ am 8.12.1924 zählt die bemerkenswertesten Arbeiten dieser bunt gemischten Schau auf, darunter solche von noch heute namhaften Malern/Grafikern wie Käthe Kuntze, Georg Richter-Lößnitz, Hans-Theo Richter und Karl Sinkwitz. Beteiligt waren auch damals in der Lößnitz ansässige Künstler, die inzwischen weitgehend vergessen sind, u.a. Arthur Götze, Curt Voigt, Rudolf Wirth und Werner Zehme. Gezeigt wurde die Ausstellung im Obergeschoss des Lusthauses, wo durch einfache Stellwände und elektrische Beleuchtung provisorische Voraussetzungen dafür geschaffen worden waren. »So wandert man ›mit vergnügtem Sinne‹ durch diese kleine Heimatschöpfung«, fand der Rezensent. (Fortsetzung folgt.)
Frank Andert