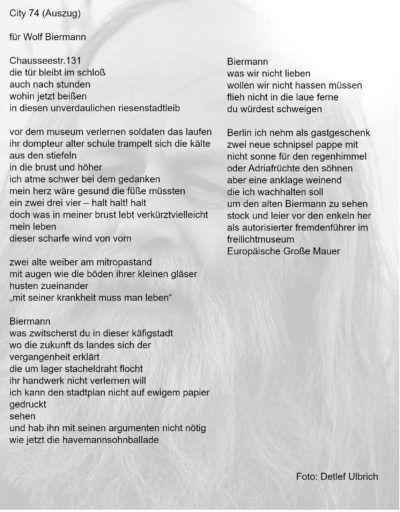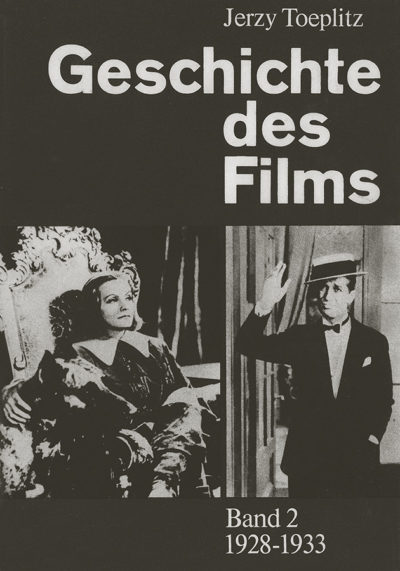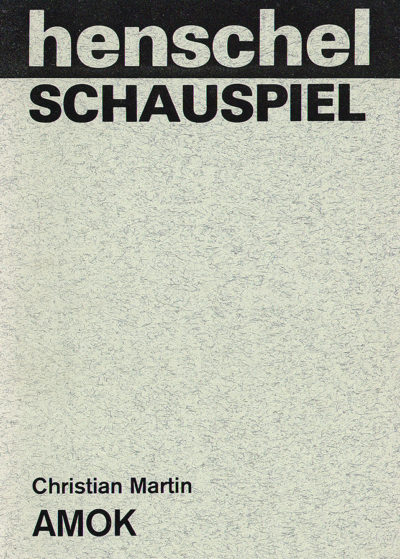Anlaß für Gedankenspiele zwischen gestern, heute und morgen
Dominierte im Jahr 2020 zunächst die nationale Nachwende-Nabelschau, wurde diese immer mehr von der Corona-Pandemie überlagert. Nur eine kurze Unterbrechung dachte man zunächst, danach geht alles weiter wie bisher. Ein großer Trugschluss! Heute sind wir klüger. Unser Blick hat sich „welt-weit-web“ geweitet.
Die Corona-Pandemie ist allerdings auch keine Begründung, um gar nichts mehr zu tun, wohl eher eine Herausforderung. Die gesundheitlichen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen sind noch lange nicht abzusehen. Auch einzelne Bereiche gegeneinander auszuspielen ergibt keinen Sinn. Geplant wird nur noch unter Vorbehalt und mehr oder weniger komplex. Die allzeitbereiten Zukunftsdeuter wurden zunehmend stiller, die sogenannten „Querdenker“ umso lauter. Dabei haben wir doch schon in der „guten Kinderstube“ gelernt: Wer schreit hat unrecht. Aber wie hängt das nun alles mit dem 750-jährigen Jubiläum von Kötzschenbroda zusammen?
Gestern habe ich mir im neuen SZ-Treffpunkt das Buch „Ich habe einen Knall“ von Oliver Kreider gekauft. Die Reaktion meiner Familie: Bist Du verrückt, willst du den etwa noch reicher machen? Natürlich war das nicht der Grund. Ich wollte wissen: Was hat uns dieser Mann mitzuteilen? Was ist ihm so wichtig, dass es in Form eines Buches Verbreitung finden soll? Immerhin schaut Oliver Kreider aus seiner „Friedens“-Burg von oben herab und weit über Radebeuls Grenzen hinaus. Ich wiederum schaue von unten nach oben, erinnere mich an Eierschecke, Apfelsaft, Sonntagsspaziergänge, den schönen Blick und meine kindliche Freude, sobald ich in der Draufsicht unser Haus entdeckt hatte. Die zerstörerische Logik der Treuhand kann ich bis heute nicht nachvollziehen, selbst wenn mich fortan der Ruf als nörgelnde Spaßbremse verfolgen sollte.

Die AG »Machbarkeitsstudie Stadtmuseum« auf Exkursion im Januar 2006 v.l.n.r.: Frank Andert, Gerd Schindler, Frank Thomas,
Dr. Dieter Schubert, Thomas Gerlach, Karin Gerhardt, Prof. Dr. Hans Dieter Blanek Foto: K.U. Baum
Doch das ist eigentlich nur Nebensache, denn spätestens hier wird es wirklich interessant. Aus Gedankenspielereien ergeben sich Fragen wie: Was und wer ist historisch relevant? Wie und wann ist Radebeul zur Stadt in ihren heutigen Grenzen zusammengewachsen? Geschah es freiwillig oder unter Zwang, als 1876 Fürstenhain, 1920 Lindenau, 1923 Naundorf, Zitzschewig und Niederlößnitz nach Kötzschenbroda eingemeindet wurden?

Gelebte Stadtteilkultur – Staffettenstabübergabe von Serkowitz an Zitzschewig im August 2009 zur Veranstaltungsreihe »Radebeuler Begegnungen« im März 2010 Foto: S. Preißler;
Und welches Kötzschenbroda ist nun eigentlich gemeint, wenn wir den 750. Geburtstag feiern: Altkötzschenbroda oder die Ursprungsgemeinde Kötzschenbroda ohne bzw. mit Kötzschenbroda-Oberort? Oder ist die Stadt Kötzschenbroda (mit ihren sechs Ursprungsgemeinden) gemeint, die allerdings nur zehn Jahre (1924-1934) existierte? Also wer ist denn nun ein waschechter Kötzschenbrodaer? Um die Verwirrung noch etwas zu steigern, stößt man auch auf Radebeul 1 bis 6 sowie Radebeul Ost, West und Mitte. Während der Bahnhof Radebeul-West in S-Bahn-Haltepunkt Kötzschenbroda umbenannt wurde, bezeichnete man das inmitten von Kötzschenbroda befindliche dritte Sanierungsgebiet der Stadt Radebeul als Sanierungsgebiet „Zentrum Radebeul-West“. Ich hoffe, die geneigte Leserschaft kann mir noch folgen.
Spannen wir nun den Bogen von der ersten urkundlichen Erwähnung Kötzschenbrodas im Jahr 1271 bis heute, wird uns zunehmend klar, wie wenig wir eigentlich über diesen langen Zeitraum wissen. Skelettfunde belegen, dass dieses Gebiet schon viel eher besiedelt war. Immer wieder fanden Naturkatastrophen, Seuchen, Kriege und gesellschaftliche Umbrüche statt. In guten wie in schlechten Zeiten galt es, den Alltag zu bewältigen. Die Menschen arbeiteten viel und hart. Sie haben sich geliebt, gefreut, gehasst und getötet. Sie haben gefeiert, gebetet, rebelliert und versucht, im irdischen Dasein einen Sinn zu erkennen.
Vieles lässt sich sowohl aus der näheren als auch der ferneren Geschichte lernen. Vorausgesetzt, man wird fündig in öffentlichen Museen und Archiven. Vermutlich weiß ein Großteil unserer künftigen Leistungsträger (Irrtum nicht ausgeschlossen!) mehr über Europa oder Amerika als über die Geschehnisse in Gegenwart und Vergangenheit vor der eigenen Haustür. Andererseits hatte sich schon Radebeuls erster Stadtarchivar Paul Brüll (1892–1983) in den 1960 er Jahren darüber beklagt, dass die Möglichkeiten des Archivs von den Schulen noch zu wenig genutzt werden würden.
Antworten auf Fragen zur Stadtgeschichte erhält man jedoch nicht nur im Stadtarchiv. Fündig wird man u. a. im Sächsischen Weinbaumuseum Hoflößnitz, im Karl-May-Museum, im Sächsischen Schmalspurbahnmuseum, im Lügenmuseum, in der Städtischen Kunstsammlung, in den Heimatstuben Kötzschenbroda und Naundorf, im Bilz-Museum, in den Kirchen und auf den Friedhöfen. Aber auch die Bibliotheken, Buchhandlungen und der Notschriftenverlag haben interessante Lektüre über Radebeul im Angebot.

Karl Reiche am häuslichen Küchentisch beim ordnen seiner handschriftlichen Aufzeichnungen im März 2010 Foto: K. (Gerhardt) Baum
Aufzeichnungen aus eigenem Erleben sind eine besonders wertvolle Bereicherung und lassen Stadtgeschichte lebendig werden. Das Tagebuch von Dr. Wilhelm Brunner (1899–1944), dem letzten Bürgermeister der Stadt Kötzschenbroda, vermittelt Einblicke, unter welchen Umständen die Vereinigung von Kötzschenbroda mit Radebeul von statten ging. Der kötzschenbrodaer Bauer Karl Reiche (1920–2017) wiederum schildert in seiner jüngst erschienenen Autobiografie „Ein Leben mit der Landwirtschaft“.
Zu den wichtigsten Informationsquellen gehören Ortschroniken, Kirchenbücher, Personenstandsregister, Adressbücher, das Stadtlexikon, die Denkmaltopografie, die Schriftenreihe zur Stadtentwicklung, das integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK), aber auch Festschriften, Vereinsdokumentationen, Brigadetagebücher, Hausbücher und, und, und …. Hinzu kommen Periodika wie „Vorschau und Rückblick“ oder die „Naundorfer Nachrichten“ sowie die lokale Tagespresse. Auch das Spektrum von themenbezogenen Sonderausstellungen ist äußerst vielfältig und aufschlussreich.
Was jedoch in Radebeul fehlt, ist ein zentraler öffentlich zugängiger Ort, an dem sich die Geschichte der Stadt und ihrer zehn Ursprungsgemeinden in aller Komplexität anhand von Sachzeugnissen zu Geologie, Besiedlung, Landwirtschaft, Industrie, Handwerk, Alltag, Politik, Kunst, Kultur, Architektur und Brauchtum sowie zu besonderen Ereignissen, sozialen Strukturen oder Persönlichkeiten usw. übersichtlich nachvollziehen lässt. Dass Radebeul die einzige Mittelstadt in Sachsen zu sein scheint, in der es kein Stadtmuseum gibt, könnte man schon fast als ein Alleinstellungsmerkmal hervorheben.
Wie es dazu kam, dass die Große Kreisstadt Radebeul eine Stadt ohne Stadtmuseum ist, vollzog sich gleitend und fast geräuschlos. Ab Mitte der 1980er Jahre begann sich die Museumsleitung zunehmend auf den inhaltlichen Schwerpunktbereich Weinbau zu konzentrieren. Aus dem einstigen Heimatmuseum Haus Hoflößnitz (bzw. Schloß Hoflößnitz) wurde das Weingutmuseum Hoflößnitz und schließlich das Sächsischen Weinbaumuseum Hoflößnitz. Der plötzlichen Erkenntnis, dass der Stadt Radebeul nunmehr etwas Wichtiges fehlen könnte, folgte die Bildung einer Arbeitsgruppe, welche eine Machbarkeitsstudie für ein künftiges Stadtmuseum erstellen sollte. Als mögliche Museumsstandorte wurden u. a. das ehemalige Postgebäude in Radebeul-West, das ehemalige Rathaus Niederlößnitz, das ehemalige Bahnhofsgebäude in Radebeul-West vorgeschlagen. Alle erarbeiteten Machbarkeits-Varianten wurden 2006 mit der Begründung zurückgewiesen, dass man die raren Steuergelder nicht mit einem Stadtmuseum „verfrühstücken“ könne.
Natürlich ist es preiswerter, sich mit fremden Federn zu schmücken. Doch die Abrechnung erfolgt zum Schluss, wenn man plötzlich als Stadt mit leeren Händen dasteht, so wie bei der Puppentheatersammlung oder dem Zeitreisemuseum.
Auch Träume können schnell zerplatzen. Vom lebendigen Handwerksmuseum in einer ehemaligen kötzschenbrodaer Korbmacherwerstatt blieb dem Verein „Zunftlade Hartmann-Hof e. V.“ nur das sorgfältig und kompetent erarbeitete Konzept. Das Heimatgeschichtliche Kabinett im ehemaligen Rosenhof hat es tatsächlich gegeben – aber leider nur für eine sehr kurze Zeit.
Warum erwähne ich das alles? Weil man aus der Vergangenheit lernen sollte. Andererseits will ich mit diesem Beitrag dazu anregen, einmal in Augenschein zu nehmen, was in den letzten Jahren außerhalb der etablierten musealen Einrichtungen entstanden ist.

Kötzschenbroda im Wandel – Abriss des Nähmaschinenteilewerkes (Nähmatag) im Februar 2013 Foto: K. (Gerhardt) Baum

Eine Sonderausstellung erinnerte im Herbst 2018 an das erste sanierte Gebäude in Altkötzschenbroda vor 25 Jahren Foto: K. (Gerhardt) Baum
Die Heimatstube Kötzschenbroda wurde 2006 eröffnet und befindet sich auf städtischem Grund und Boden im ehemaligen Auszugshaus eines historischen Dreiseitenhofes. Für das fehlende Stadtmuseum ist das natürlich kein Ersatz. In drei Etagen und auf einer Fläche von insgesamt etwa 30 m² können die Besucher etwas über die Geschichte und den gelebten Alltag von Kötzschenbroda erfahren. Die Bewirtschaftung der Einrichtung erfolgt durch die städtische Galerie in Zusammenarbeit mit der AG Kötzschenbroda. Eine Besichtigung ist auf Anfrage möglich.
Die AG Stadtmuseum wiederum durfte von 2010 bis 2013 das Dachgeschoß eines Schulgebäudes für Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Lagerzwecke nutzen. Danach erfolgte der Umzug in die wesentlich kleineren Räume des Wasaparkes, wo sich seit 2014 auch das Radebeuler Stadtarchiv und die Städtische Kunstsammlung befinden. Am neuen Standort haben seitens der AG keine Ausstellungen und Veranstaltungen mehr stattgefunden. Diesbezügliche Aktivitäten erfolgten extern.
Die 2011 eröffnete Naundorfer Heimatstube wird privat betrieben. Im Untergeschoß befindet sich ein Schreib- und Kreativcafé mit reichlich Platz für Workshops und kleine Feierlichkeiten. Im Obergeschoß werden alte Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände sowie Bild- und Textdokumente aus Naundorf gezeigt. Ein Großteil des ausgestellten Spielzeuges kann auch benutzt werden. Vor allem Familien sind herzlich willkommen. Die aktuellen Öffnungszeiten sind der Homepage zu entnehmen.
Das Bilz-Museum im Eingangsbereich des Bilzbadgeländes wurde durch den Bilzbund angeregt und ausgestaltet. In einem kleinen Gebäude mit original erhaltener Bausubstanz wird seit 2012 an das Wirken des Naturheilkundlers und Lebensreformers Friedrich Eduard Bilz (1842–1922) erinnert. Die Besichtigung kann während der Badesaison und darüber hinaus auf Anfrage beim Bilzbund erfolgen.
Zum 350. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrages zwischen Schweden und Sachsen im Pfarrhaus zu Kötzschenbroda wurde 1995 in der Friedenskirche ein Gedenkraum eingerichtet, der an dieses bedeutende Ereignis erinnert und zu den Öffnungszeiten der Kirche frei zugängig ist.
Auch die „Stolpersteine“ auf der Moritzburger Straße in Radebeul-West sind ein wichtiger Bestandteil unserer Erinnerungskultur, die es an die nächste Generation zu übermitteln gilt.
Engagierten Freizeithistorikern, Heimatforschern bzw. Multiakteuren wie Lieselotte Schließer (1918–2004), Isolde Klemmt (1927–2008), Gottfried Thiele (1936–2006), Hans-Georg Staudte, Erika Krause, Gudrun Täubert, Gert Morzinek oder Barbara Mazurek sind kaum jüngere nachgefolgt. Die IG Heimatgeschichte und der Kunstverein haben sich hauptsächlich wegen Überalterung aufgelöst. Gegenwärtig aktiv sind in Radebeul der „verein für denkmalpflege und neues bauen“, der Dorf- und Schulverein Naundorf, der Heimatverein Wahnsdorf, der Bilzbund, die AG Stadtmuseum und die AG Kötzschenbroda. Anzumerken wäre hier allerdings, dass diese Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Letztendlich ist festzustellen, dass in Bezug auf die beschriebene Problematik in Radebeul zahlreiche lose Enden existieren, die es miteinander zu verknüpfen gilt. Wer, was, wann und wo zu stadtgeschichtlichen Themen anbietet, das sollte für interessierte Heimatfreunde und Touristen in Form einer Übersicht unkompliziert ersichtlich sein. Auf den frischen Wind aus dem Radebeuler Kulturamt und die kreativen Impulse der Bürger, Künstler und Vereine sind wir vorurteilsfrei gespannt.
Der 750. Geburtstag von Kötzschenbroda könnte einen würdigen Anlass für Initiativen und Beiträge der unterschiedlichsten Form bieten. Die Redaktion des Monatsheftes „Vorschau und Rückblick“ würde sicher gern darüber berichten.
Karin (Gerhardt) Baum