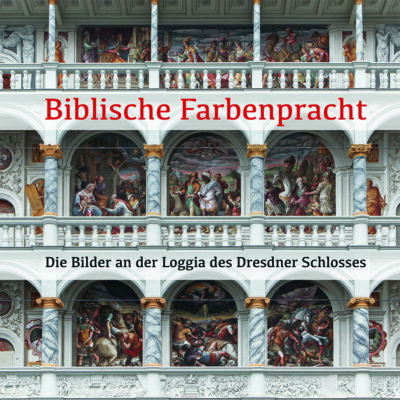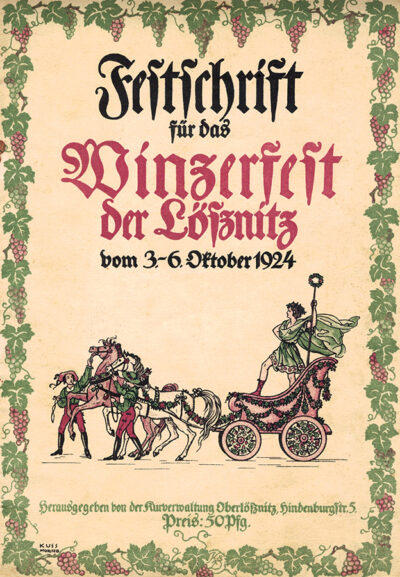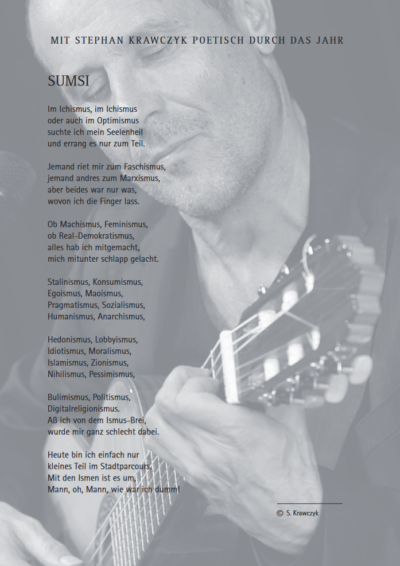Geschichten aus der Kindheit – (Teil 4/12)
November und Advent
Der November war für uns Kinder vom Totensonntag geprägt, zumal wir wussten, dann kam der Advent. Wenn wir zu Heyls in die Gärtnerei kamen, stand Frau Heyl in dem kleinen Aufenthaltsraum, dicht umgeben von Fichtengrün, Zapfen und Statizen und fertigte seit Tagen meisterhaft Kränze und Grabsträuße an. Immer noch habe ich den würzigen Geruch des Bindegrüns in der Nase. Wir durften helfen, die braunen Käppchen von den Weidenkätzchen abzuziehen, die Vater Heyl von hinten aus dem Garten brachte. Silbrig glänzend kamen die Kätzchen aus ihrer Hülle. Am Sonnabend vor dem Totensonntag und am Sonntag selbst halfen wir mit, die Kränze und Gebinde mit dem Handwagen zum Friedhof zu schaffen. Dort wurden sie von Vater Heyl mit klammen Fingern an den Mann gebracht. Der Ostwind pfiff am Totensonntag schon eisig.
Das kriegten wir auch mit, wenn wir mit Oma hinüber nach Kaditz gingen. Durch den Grabkranz wurde ein Spazierstock gesteckt und Wolfgang und ich fassten jeder an einem Ende an. Oma trug das Herz aus blaugrünen Rentiermoos, das sie extra bei Frau Heyl bestellte und das mir besonders gut gefiel. Auf dem Heimweg sahen wir die Wintersonne hinter den Türmen von Niederwartha glühend rot untergehen und Oma sagte dazu: „Die Englein backen schon, seht wie der Backofen glüht.“ Das gab ein kribbeliges Gefühl der Vorfreude auf die kommende Adventszeit.
Wenn ich an die Adventszeit bei uns im „Weißen Roß“ denke, dann war es in den niedrigen Räumen besonders heimelig. Wir konnten es kaum erwarten, bis die Kiste mit den Adventssachen aus der Bodenkammer geholt wurde. Freudig wurde jeder Räuchermann, Engel und Bergmann, der Nußknacker mit der langen Nase und der Adventskranz wieder begrüßt. Alles wurde am alten Platz aufgebaut und Muttel steckte Fichtenzweige hinter die Bilderrahmen, die dann natürlich furchtbar nadelten.
Es war Tradition, dass am ersten Adventstag Heyls Kinder rüber kamen und wir am zweiten Advent hinüber gingen. Auch bei Heyls war die Stube adventlich geschmückt und über allem lag ein zarter Räucherkerzenduft. Die heutigen Räucherkerzen stinken in der Regel. Jedes Kind hatte bei uns in jedem Jahr immer seine besondere Tasse, es waren Mokkatässchen verschiedener Art. Meins war einem grünen Blatt nachgebildet und ich liebte es sehr. Zum Lichterschein gab es Adventsplätzchen und Kakao und danach wollten wir immer wie in jedem Jahr – von Muttel vorgelesen – Peter Rossegers „Wie ich die Christtagsfreude holen ging“ anhören. Gewissenhaft wurde an jedem Adventssontag ein Licht mehr angezündet und wenn vier Kerzen endlich brannten, dann war Weihnachten da.
Vater bastelte mir einmal ein ziemlich großes Hexenhaus, Ausschneidebogen waren damals besonders in Mode. Muttel stellt für jedes von uns Kindern ein geheimnisvolles Glas ins Fenster der Kinderstube.
Es war streng verboten, die Hütchen hoch zu heben, denn darunter sollten in aller finsterer Ruhe die Hyazinthenzwiebeln keimen. Zuerst entdeckten wir zarte Würzelchen im Glas, die immer voller und länger wurden. Hob die Hyazinthe ihr Hütchen selbst empor, konnte es abgenommen werden. Ein Blütenwunder in Rosa, Weiß und Blau zur Weihnachtszeit. Wie war unsere Kindheit angefüllt mit kleinen Wundern, bereitet von der Liebe aller, die um uns waren.
So ging der November unserer Kinderzeit in den Weihnachtsmonat über.
Christa Stenzel/ Christian Grün