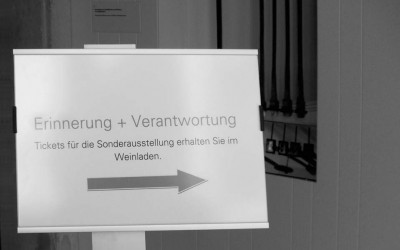In jüngster Vergangenheit hat uns das Weingutmuseum Hoflößnitz, das sich neuerdings, ohne viel Aufhebens von der Neuerung gemacht zu haben, »Sächsisches Weinbaumuseum« nennt, mit seinen wechselnden Ausstellungen nicht eben verwöhnt. Die letzte wirklich sehenswerte historische Sonderausstellung, damals zur Geschichte des Terrassenweinbaus, liegt schon etliche Jahre zurück. Umso gespannter richten sich die Blicke nun auf die erste Schau unter der neuen Museumsleitung: »Erinnerung + Verantwortung. Sächsischer Weinbau im Nationalsozialismus«. Da sich die Exposition auch gleich höchster politischer Aufmerksamkeit erfreuen durfte, kann auch die Vorschau daran nicht kommentarlos vorbei. Gleich zwei Redaktionsmitglieder haben ihre Gedanken dazu zu Papier gebracht.
Mutiger Tabubruch und enttäuschte Gesichter
Das Thema Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter im sächsischen Weinbau in den 30er und 40er Jahren, ein politisch-menschliches Thema, hatte die neue Leitung der Hoflößnitz aufgegriffen und als Ausstellung gestaltet. In verschiedener Hinsicht eine schwere Aufgabe; der Mut, sie jetzt anzugehen, verdient Anerkennung.

Die Ankündigung der Ausstellung von Frau Dr. Giersberg in Heft 8 von ›Vorschau & Rückblick‹ hat neugierig gemacht, aber auch polarisiert – so hörte ich auch Stimmen von Radebeulern, denen die Hoflößnitz nicht fremd ist, dass das nicht ihr Thema sei.
Zur Eröffnung am Abend des 27. Juli 2010, einem schönen Sommerabend, waren im Hof des Weinguts schätzungsweise 250 Gäste erschienen, so viele wie der Festsaal sicherlich nicht gefasst hätte. Hier ein paar Passagen aus den Beiträgen der Festredner:
Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich näherte sich dem Thema in seiner Rede über den lateinischen Spruch »in vino veritas« – die Suche nach der Wahrheit verlange es von uns, eine Stellung zu dem Thema einzunehmen, weiteres Verschweigen sei keine Lösung!
Bert Wendsche, Radebeuls OB, versuchte den Vergleich mit einem Puzzle, wenn er sagte, dass Geschichte, hier die des Radebeuler Weinbaus, sich immer aus vielen Puzzleteilen zusammenfüge. Bisher hätte ein wichtiges Teil im Puzzle gefehlt, das wir heute hinzufügen könnten.
Museumsleiterin Dr. Bettina Giersberg, stellte in ihrer Rede dar, dass nun endlich die Leistungen der Kriegsgefangenen zweier Weltkriege (bereits 1916 halfen französische Gefangene den Kötzschenbrodaer Wasserturm zu errichten) und Zwangsarbeiter in Radebeul mit Rodungsarbeiten, Mauersanierung und Setzen neuer Weinstöcke und den damit verbundenen Leiden erstmals öffentlich gewürdigt werden könne. Dabei solle die Beteiligung und Schuld der Deutschen nicht geleugnet werden, wir müssten aber lernen, mit der Erinnerung oder Überlieferung richtig umzugehen.
Dr. Dieter Schubert, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Weinbaumuseum Hoflößnitz, betonte: Mit der Ausstellung werde ein Tabu gebrochen, nach 65 Jahren könne über das Thema gesprochen und eine Ausstellung gezeigt werden. Die Arbeit der Menschen in der Zeit des so genannten 3. Reichs im Weinberg zeige eine politische Dimension, die bisher keine andere Ausstellung in der Hoflößnitz hatte. Dabei sollten wir auch die schwere Arbeit unserer Winzerfrauen sehen und würdigen, deren Männer als Soldaten und spätere Gefangene lange abwesend waren.

Beim anschließenden Betrachten der Ausstellung waren dann nicht wenige erstaunt, wie klein diese Ausstellung eigentlich ist – ein Zimmer und der Vorraum im Kavalierhaus, mehr nicht! Allerdings waren die Dokumente vorwiegend authentisch, gut ausgewählt und mit neuem Ausstellungsmobiliar entsprechend präsentiert. Lag die Beschränkung daran, dass aus der Zeit so wenig ausstellbares Material vorlag, oder lag es nur an den räumlichen Möglichkeiten? Eine gewisse Enttäuschung war in Gesprächen der Besucher zu spüren, zumal für die Sonderausstellung noch extra Eintritt erhoben wird. Der Sinn der auf der Südseite dem Kavalierhaus angefügten halbrunden Wand mit Gucklöchern und einer Kötzschenbrodaer Fototapete auf der Innenseite war schwer nachzuvollziehen. Wollte man so durch eine aufwändige Verdunklung des Raumes irgendwie die »finstere Zeit« von 1933 bis 1945 suggerieren?

Auf unseren OB hatte man es gleich mehrfach abgesehen: Der Ministerpräsident sprach ihn mit Herr Doktor an – was nicht ist, kann ja noch werden –, und die 3. Ausgabe des Blättchens »Hoflößnitzer Sommerspiele« kennt gar einen Bernd Wendsche, der so zeitweise auch auf der Internetseite der Hoflößnitz in Erscheinung trat…
Aus Anlass der Ausstellung wurde in der Spitzhaustreppe eine Messingtafel angebracht, die an die Arbeit der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter erinnert und sie würdigt. Eine gute Idee als begleitende Maßnahme, hoffen wir, dass die Tafel lange hält bzw. bleibt!
Dietrich Lohse
Ein optisch ansprechender Vorgeschmack
Warum sich einige unserer Stadträte ein reflexartiges Murren nicht verkneifen konnten, als das Thema der neuen Sonderausstellung vor einem Dreivierteljahr bekannt wurde, hat sich mancher gefragt. Dieser falsch verstandene Lokalpatriotismus weniger wird Radebeul nun in fast jedem Pressebericht über die Ausstellung neu unter die Nase gerieben. Die Ausstellungsmacher hätten sich das besser nicht wünschen können, denn derartiger »Widerstand« bedient ein Klischee, trägt zur Aufmerksamkeit bei und fördert die allgemeine Unterstützungsbereitschaft. Stadt und Land, die eigene und andere Stiftungen stellten sich voll hinter das Projekt, und großzügige Sponsoren wurden gefunden. Dass die Liste der Danksagungen, auf der die eingangs erwähnten Stadtverordneten eigentlich mit hätten verzeichnet sein müssen, nun fast so lang ausfällt wie die Liste der Exponate, zeigt ebenso wie der Besucheransturm zur Eröffnung, dass das Projekt in Wirklichkeit offene Türen einrannte. Das ist allerdings auch eine schwere Hypothek, denn das forsch und groß formulierte Thema und die vollmundigen Ankündigungen weckten natürlich Erwartungen, die de facto von vornherein – ohne wissenschaftlichen Vorlauf und auf engstem Raum – auch nicht ansatzweise zu befriedigen waren.
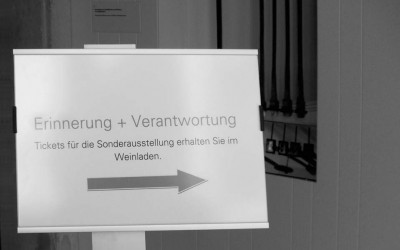
Der sächsische Weinbau im Nationalsozialismus – dieser »noch viel zu wenig beleuchtete Bereich der sächsischen Regionalgeschichte« wird leider (anders, als es die Einleitung verspricht) auch in der neuen Ausstellung viel zu wenig beleuchtet. Erinnert werden soll daran, dass Weinbau harte Arbeit ist (kein Winzer wird das bestreiten), dass der sächsische Weinbau in den 30er Jahren stark gefördert wurde (ein dunkles Geheimnis war das für Interessierte nicht) und dass während des Zweiten Weltkriegs zahlreiche Kriegsgefangene und »Fremdarbeiter« unter oft unmenschlichen Bedingungen zwangsweise im sächsischen Weinbau arbeiten mussten. Als Fußnote zur Bemerkung, dass das Schicksal der Letzteren durch diese Ausstellung erstmals öffentlich gewürdigt werde, eine der Kernthesen des formulierten Anliegens, hätte man sich zumindest einen kurzen Hinweis auf die akribischen Recherchen von Eberhard Sennewald zum Kriegsgefangenenlager Hoflößnitz gewünscht, deren Ergebnisse schon 2006 auszugsweise in der ›Vorschau‹ publiziert worden sind. Damals ging es zwar nur um ein Beispiel, aber wie anders lassen sich Schicksale anschaulich vermitteln – durch ein paar karge, im Brustton politisch korrekter Betroffenheit servierte Informationshäppchen eher allgemeiner Natur jedenfalls kaum.
Die Idee, für die kleine Sonderausstellung extra Eintritt zu erheben, überrascht angesichts des politischen Bildungsanspruchs. Touristische Museumsbesucher zahlen in diesem Jahr (Jugendliche ausgenommen) ohnehin mehr als im letzten, und was die Einheimischen betrifft, die sich vielleicht lediglich die Sonderausstellung ansehen möchten und die es gilt, wieder stärker für die Hoflößnitz zu interessieren, hätte man sich daran erinnern können, dass sie es sind, die das Museum – über den städtischen Haushalt – maßgeblich finanzieren. Genau genommen kostet der volle Eintritt nämlich auch nicht zwei, sondern fünf Euro. Denn ohne die lesenswerten, aber nicht wirklich vertiefenden Texte im für drei Euro erhältlichen Begleitheft, das aus unerfindlichen Gründen als »Begleitband« bezeichnet wird, bleiben die historischen Zusammenhänge des Themas und die Kapitelgliederung der Ausstellung praktisch unverständlich. Am Platz kann es nicht gelegen haben, dass diese kurzen Texte in der Ausstellung selbst nicht zu lesen sind, denn obwohl bedauernd darauf hingewiesen wird, wie wenig Ausstellungsfläche zur Verfügung stand, macht der kleine Ausstellungsraum einen erstaunlich aufgeräumten Eindruck.

Von der gestalterischen Seite betrachtet, ist die Schau sehr ansprechend, auch wenn man – die Budgetdiskussionen der letzten Jahre im Hinterkopf – lieber nicht fragen will, was der Spaß gekostet hat. Gediegen gearbeitete Aufsteller geben zusätzliche Präsentationsmöglichkeiten, und die als Blickfang eingearbeitete Kopie eines zeitgenössischen Glöckner-Sgraffitos verfehlt ihre Wirkung nicht, auch wenn sie die Ankündigung, man würde vorwiegend bislang Ungesehenes präsentiert bekommen, gleich am Eingang mit einem Fragezeichen versieht. Der Grundgedanke war anscheinend, den vornehmen Minimalismus der Dauerausstellung auf die Sonderausstellung zu übertragen und die sorgfältig drapierten Exponate weitestgehend für sich sprechen zu lassen. Aussagekräftige Dokumente zum Thema zu finden, war jedoch offenbar ein großes Problem, und manchem Sachzeugnis hätte man den Mund ruhig etwas weiter öffnen können. Dass das Kavalierhaus, wo die Ausstellung gezeigt wird, selbst jahrelang als Kriegsgefangenenlager diente, wird beispielsweise nur en passant erwähnt. Und wenn das Glück den Machern etwa persönliche Erinnerungsstücke eines ehemaligen Zwangsarbeiters aus Belgien zuspielt, darunter ein Tagebuch, könnte sich das Publikum unter Umständen fragen, was denn da so drinsteht, wenigstens auf der aufgeschlagenen Seite. Hätte man die gleiche Sorgfalt wie auf die Inszenierung auch auf die Beschriftung der Exponate verwandt, wäre mancher Druckfehler vermeidbar und der blass-»rote Faden« der Exposition vielleicht deutlicher erkennbar gewesen. Gern reden wollten zahlreiche Zeitzeugen, hieß es im Vorfeld. Den Ertrag dieser Interviews sucht man im Moment noch vergeblich, aber ein bereits installierter Monitor deutet darauf hin, dass da noch etwas zu erwarten ist.

Warum wird dieses gediegene »Ausstellungsgesamtkunstwerk« überhaupt als Sonderausstellung vermarktet? Im Sinne der nachhaltigen Vermittlung der intendierten Botschaft und auch, um dem zweiten Wort im Titel – Verantwortung – zu entsprechen, wäre es vielleicht nicht unklug gewesen, die Schau als längst überfällige thematische Erweiterung der Dauerausstellung zu präsentieren. Der MP hätte sich dann zur Eröffnung zwar vielleicht vertreten lassen, aber man wäre auch nicht Gefahr gelaufen, von Besuchern, die den kurzen Rundgang vor Erwerb einer Eintrittskarte in Minutenschnelle absolviert haben, gefragt zu werden, wo denn die Sonderausstellung richtig losgeht, über die neulich so viel in der Zeitung stand. Ganz aus der Luft gegriffen ist dieses Beispiel übrigens nicht.
Man will nicht hoffen, dass diese Sonderschau, wie es im Begleitheft abschließend heißt, Standards für die Zukunft gesetzt hat. Sie bietet einen gestalterisch ansprechenden Vorgeschmack, ohne ihr großes Thema wirklich zu bewältigen. Die vorgetragenen Kritikpunkte sollen aber auch nicht falsch verstanden werden. Die derzeitige räumliche Situation des Museums lässt große Sprünge einfach nicht zu, und nach wenigen Monaten der Einarbeitung darf man von der neuen Leiterin, die ein schwieriges Erbe angetreten hat, keine Wunder erwarten. Bei aller Kritik ist es ausdrücklich begrüßenswert, dass sich das Weingutmuseum, das im neuen Konzept der »Marke Hoflößnitz« etwas ins Hintertreffen zu geraten schien, dieses Themas angenommen und überhaupt unter neuer Leitung wieder einen Draht nach außen gesucht und gefunden hat.
Frank Andert
[V&R 9/2010, S. 11-16]