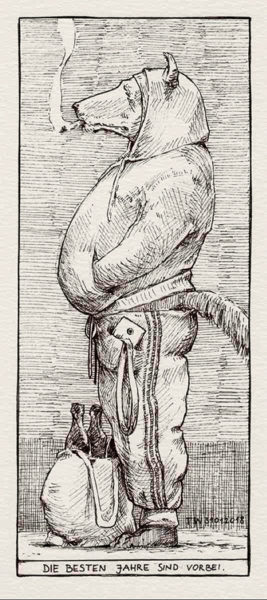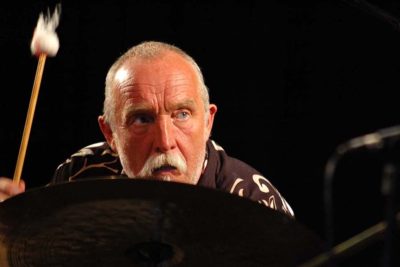Zur aktuellen Sonderausstellung in der Hoflößnitz
Mit dem chinesischen Neujahrsfest am 16. Februar begann im Reich der Mitte, astrologisch betrachtet, das Jahr des Hundes, das im chinesischen Horoskop ausgesprochen positiv konnotiert ist. »Mit dem Hund tritt Vernunft, Ordnung und Gerechtigkeit in die Welt. […] Als elftes Tierkreiszeichen kombiniert er Kreativität, Tatkraft und Pragmatik«, ist im weltverbindenden Netz zu lesen. Auch das Weinbaumuseum Hoflößnitz ist seit dem »Tag des offenen Denkmals« auf den Hund gekommen, nicht im wenig schmeichelhaften übertragenen Sinne, sondern ganz wörtlich. Im Fokus der noch bis 25. November laufenden diesjährigen Herbstausstellung stehen nämlich die beim flüchtigen Gang durch das reich ausgemalte Obergeschoss im Lust- und Berghaus der Hoflößnitz leicht übersehenen Hundedarstellungen an den Wänden des kurfürstlichen Wohngemachs.
Der Bauherr des kleinen Weinbergschlösschens, Kurfürst Johann Georg I. (1585-1656), war ein leidenschaftlicher Jäger, ja nachgerade ein Nimrod. Die heute in der Sächsischen Landesbibliothek verwahrte »Summa Summarum Alles Hohen und Niedrigen Wilperts [Wildbrets] so Ihre Churfürstliche Durchlauchtigkeit von Anno 1611 bis 1650 in Jagen, Pirschen, Streiffen und Hetzen gefangen, geschossen und gehatzt« weist allein für die ersten knapp vierzig Jahre seiner langen Regentschaft die sagenhafte Strecke von 101.603 Stücken Wildes aus, vom Hirsch bis zum Hamster, vom Bären bis zum Biber und vom Eber bis zum Eichhörnchen. »Gefangen, geschossen und gehatzt« hat er die natürlich nicht allein, sondern mit Unterstützung einer vielköpfigen Schar zwei- und vierbeiniger Helfer, und unter letzteren spielten Hunde bei allem »Jagen, Pirschen, Streiffen und Hetzen« eine wesentliche Rolle.
Der Himmel von Johann Georgs Jagdzimmer in der Hoflößnitz ist mit Ölgemälden von vielerlei Arten des jagdbaren Wildes tapeziert, darunter besondere Trophäen wie der Hirsch mit dem »Vornembsten gehörne der Enden« und »Das gröste schwein an gewichte«. An den Wänden führen leicht bekleidete Nymphen zwölf annähernd lebensgroß dargestellte Jagdhunde an der Leine – ein Zyklus, der wie so manches in diesem und den Nachbarräumen seinesgleichen sucht –, darunter sehr wahrscheinlich ebenfalls Porträts einiger Lieblingshunde des Fürsten, die durch die mit seinen Initialen gekennzeichneten Halsbänder aus der Meute herausstechen.
Anhand von Standardwerken der zoologischen und Jagdliteratur des 16. bis 18. Jahrhunderts führt die von der Radebeuler Kunsthistorikerin Dr. Magdalene Magirius kuratierte Schau vor Ort die Funktion der dargestellten Hunde im Rahmen der seinerzeit gebräuchlichen Jagdformen vor Augen. Diese beleuchtet der unter reichlich Requisiten mit einigen besonderen Schätzen aufwartende Ausstellungsteil im Kavalierhaus der Hoflößnitz näher, die auch der mit Jagd und Wein verbundenen Willkommens(s)kultur zur Zeit Augusts des Starken nachgeht. Die von ihm in der kurfürstlichen Lößnitz veranstalteten Feste zur Weinlese kamen selten ohne jagdliche Begleitmusik aus. Und, wie Hanns Friedrich von Flemming vor 300 Jahren bemerkte: »Bey solcher angestellter Herrschaftlichen Lust wird es niemahlen, sonderlich wegen Bier und Wein so genau genommen, welches der Herrschaft zu hohen Ehren gereichet, und kan ein Jeder bey solcher Lust sich ein klein Räuschgen trincken.«
Tag des offenen Denkmals ist im Sächsischen Weinbaumuseum bei mäßigem Eintritt ja eigentlich fast immer (geöffnet 10-18 Uhr, außer montags). Eine besonders passende Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung »Hund und Wild – die kurfürstliche Jagdlust im Spiegel der Tierdarstellungen in der Hoflößnitz« – und sicher auch zum Trinken eines »kleinen Räuschgens« – bietet sich jedoch am ersten Oktoberwochenende, wenn zum »3. Churfürstlichen Weinbergfest« vom 5. bis 7. Oktober jeweils ab 12 Uhr einmal mehr Jagdgöttin Diana aus ihrem Bilde ins pralle Leben tritt und gemeinsam mit Bacchus das Zepter in der Hoflößnitz übernimmt.
Frank Andert