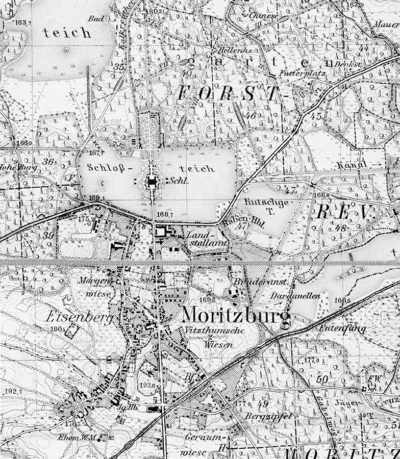Kunststudenten und Meisterschüler in der Radebeuler Stadtgalerie
„Es war eine der interessantesten Ausstellungseröffnungen, die wir hier bisher erlebt haben…“ schrieb ein Radebeuler Ehepaar ins Besucherbuch.
Noch nie hat man so viele junge Menschen zu einer Ausstellungseröffnung in der Stadtgalerie gesehen. Sie mischten sich mit den Älteren, saßen in Grüppchen auf der Wiese und diskutierten bis spät in die vorsommerlich laue Nacht. Selbst der Rektor der Dresdner Kunsthochschule Matthias Flügge war gekommen und sehr angetan.

Prof. Ralf Kerbach (3.v.l.) mit Kunststudenten beim Ausstellungsaufbau
Bild: K. Baum
Die Gastredner, locker aufgelegt, erhielten viel Beifall. Das Repertoire der Studentenband „Pfürsichkompott“ beinhaltete Freejazzavantgardistisches sowie dadaistische Klangperformationsmomente und liedermacherische Werke.
Ein Gemälde wurde sogar in den Nußbaum gehängt. Die kleinen Flügel am Kopf des Porträtierten spielen auf Hermes an, den Schutzpatron der Gaukler, Diebe und (Kunst)Händler. Mit einer Bierflasche in der einen und einer Zigarette in der anderen Hand, schaut er schelmisch auf das Geschehen im den Hof herab. Ein Banner an der Hauswand sollte mit dem Spruch „Nur der Provinzielle hat Angst vor der Provinz“ provozieren, doch von Berührungsängsten war weit und breit nichts zu spüren.
Der Gedanke, über die Dresdner Hochschule für Bildende Künste (HfBK) auf den künstlerischen Nachwuchs zuzugehen, war nicht neu. Doch wie stellt man das an? Der Umstand, dass Prof. Ralf Kerbach, Jahrgang 1956, an der Dresdner Kunsthochschule Malerei und Grafik lehrt, kam unserer Absicht sehr entgegen. Radebeul ist ihm vertraut. Allerdings sind seine Beziehungen zur Lößnitzstadt sehr ambivalent. Hier besuchte Kerbach die Schule, bezog er sein erstes Atelier, erregte er mit einer Gruppe von Künstlern politisches Aufsehen und hier lernte er Künstler wie Theodor Rosenhauer, Werner Wittig, Claus Weidensdorfer und Gunter Herrmann kennen. Mit Cornelia Schleime und dem Radebeuler Peter PIT Müller präsentierte er sich 1991 in der Stadtgalerie in Radebeul-Ost.

Eine, der zwei Bandformationen von »Pfürsichkompott«
am Eröffnungsabend
Bild: K. Baum
Mit unserem Anliegen rannten wir bei Kerbach gewissermaßen offene Türen ein. Der administrativen Form musste allerdings entsprochen werden. Kerbach vermittelte zur Hochschulleitung und motivierte seine Studenten in der Radebeuler Stadtgalerie auszustellen, denn Gemeinschaftsprojekte stärken den Zusammenhalt der Gruppe. Zwischen der HfBK und der Stadtgalerie wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Alles Weitere ergab sich wie von selbst und entwickelte eine mitreißende Dynamik. Für beide Partner eine neue Erfahrung.
Die „Kerbachklasse“ ist wohl eine der größten an der Dresdner Kunsthochschule. Dass letztlich 23 Studenten unterschiedlicher Jahrgänge und 4 Meisterschüler ihre Teilnahmebereitschaft signalisierten, hatte uns dann doch überrascht.
Der „Praxis-Stress-Test“ umfasste einen sehr komplexen Aufgabenbereich. Vom Finden eines Ausstellungstitels, über die Gestaltung der Druckerzeugnisse, die Vorauswahl der Exponate und deren Hängung im Innen- und Außenraum bis zum Eröffnungsprogramm. An zwei Tagen flutete die „Kerbachklasse“ unsere kleine städtische Galerie. Eine längere Vorbereitungsphase war dem vorausgegangen.
Der Ausstellungstitel „SMS – Sprösslinge Mit Spass“ zeugt von lebenspraktischer Selbstironie, was durch die Abbildung auf Einladung und Plakat anschaulich illustriert wird. Aus der fruchtbaren Scholle keimen viele Sprösslinge, doch nur einem Pflänzchen gelingt es, nach oben zu wachsen, während die anderen im Untergrund verschwinden.

Bild: K. Baum
Was macht die „Kerbachklasse“ aus? Kerbach, der sich selbst nie anpassen wollte, ermuntert seine Studenten eigene Wege zu beschreiten, lässt ihnen viel Freiraum, wohl auch bedingt durch seine eigene Biografie. Es ist schon paradox, dass Kerbach seit 1992 an jener Hochschule lehrt, die ihn 1979 zur Exmatrikulation gedrängt hatte. Die Schüler der „Kerbachklasse“ empfinden sich nicht als Epigonen, schon eher als eine Gruppe aus Individualisten. Die Hochschule ist für sie ein Schutzraum, der die Möglichkeit bietet, sich zu orientieren, auszuprobieren, mit Kommilitonen auszutauschen und alles kritisch zu hinterfragen. Behutsam werden sie dabei von Dozenten flankiert. Selbst wenn es immer wieder Situationen gibt, wo ihnen der Spass vergehen könnte, wollen sie sich den Spass am Leben, den Spass am künstlerischen Tun nicht nehmen lassen.
Die Vielfalt der Themen, Handschriften und Techniken fällt auf. Man spürt die Lust am Experimentieren. Was allerdings dominiert, ist die Malerei. Die menschliche Figur steht dabei häufig im Mittelpunkt. Nicht ohne Grund ist man in der „Kerbachklasse“. Da wird gerungen um Farbe, Form, Struktur und Raum. Ihres spannungsgeladenen Umfeldes sind sich die Kunststudenten durchaus bewusst. Der Traum von der Kunst um der Kunst willen scheint ausgeträumt. Es geht ihnen um Inhalte und es geht ihnen darum, den Betrachter zu berühren.
So wurde an zentraler Stelle im Untergeschoss der Galerie das Gemälde „under the trees“ (unter den Bäumen) platziert. Der Betrachter ist fassungslos. An den Bäumen hängen zwei Menschen, darunter völlig teilnahmslos die gleichgültige Menge, als wäre das alles ganz normal. Oder das Bild im Eingangsbereich, auf dem die Köpfe bekannter Staatsmänner zu sehen sind, verbunden mit der simplen Botschaft „vertragt euch“, was sich weiterdenken ließe: Wir wollen auch noch eine Zukunft haben.
Es hat sich gelohnt, aufeinander zuzugehen. Die kleine provinzielle Stadtgalerie auf den künstlerischen Nachwuchs aus der „Kerbachklasse“ mit Wurzeln in Bulgarien, Polen, Südkorea, Türkei, Iran, China, den alten und neuen Bundesländern. Aus Vorurteilen wurde Zuversicht. Miteinander reden und arbeiten, das könnte schon ein guter Ansatz sein.

Bild: K. Baum
Der Dresdner Künstler und Galerist Holger John mailte uns: „Eine wunderbare Vernissage und Ausstellung. Der Schritt ist nur zu begrüßen! Bravo. … einmal junge Sprossen, die wohl gut keimen, wachsen erst wollen, auszustellen … herrliche abendliche Atmosphäre, und für den inneren älteren Zirkel, die schon gereiften Zweige auch ergötzlich, die Mischung tats dann, Jung und Alt, geht doch zusammen … Schluss mit Monokultur … und sie können voneinander lernen, diese Gewächse … weiter so. Glückwunsch!“
Zur Finissage mit den Sprösslingen der Kerbachklasse und einer Portion „Pfürsichkompott“ sind am 25. Juni um 19 Uhr alle, die sich für den Spass am Spass Interessieren herzlich eingeladen.
Karin (Gerhardt) Baum
Aus der Kerbachklasse in der Stadtgalerie Radebeul: Swantje Ahlrichs, Petar Bocin, Anne-Cathrin Brenner, Michael Broschmann, Robert Czolkoß, Anna Ditscherlein, Lena Dobner, Marcus Eck, Michaela Fenzl, Albert Gouthier, Merlin Grund, Danny Hermann, Carlotta van der Heyden-Rynsch, Teresa Hilliger, Lion Hoffmann, Gene Hünniger, Julia Johansson, Joo Young Kim, Sina Neuberger, Murat Önen, So Young Park, Ana Pireva, Mona Pourebrahim, Hamidreza Yaraghchi, Tillmann Ziola, Shengjie Zong, Helena Zubler