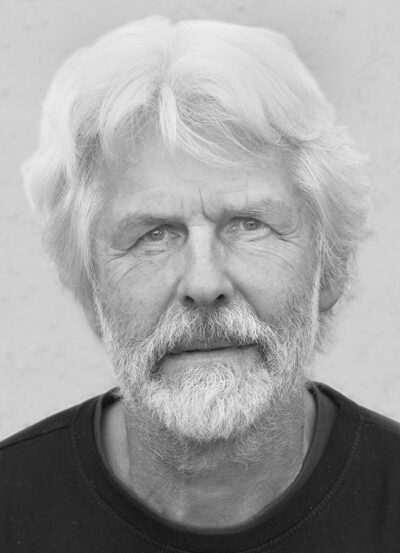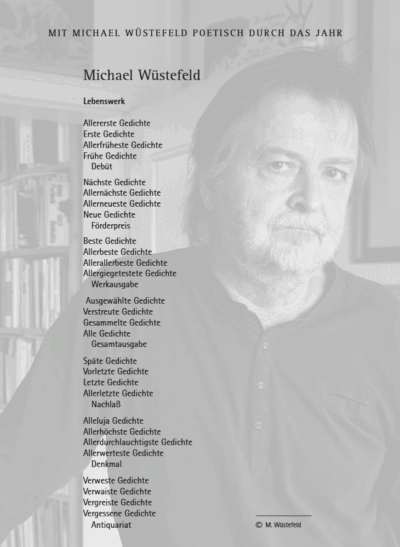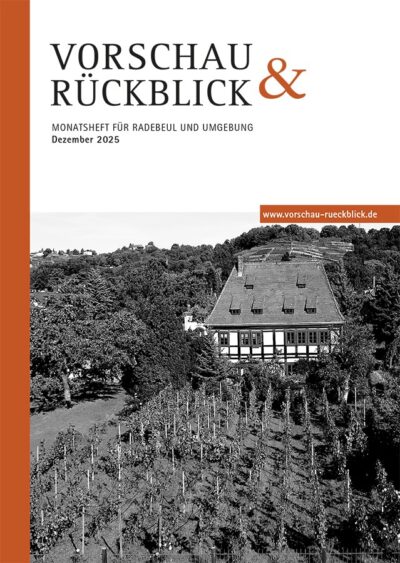Fortgesetzter Versuch
Beleidigt und mit dem Rücken zum Tagesgeschehen sitzt der Kater unter dem Tisch. Er hat noch nie – wirklich: noch nie! – etwas von einer gedeckten Kaffeetafel gehört, und er hat natürlich auch keine Ahnung, was ein Milchkännchen ist. Das aber ist umgekippt, mitten auf dem Tisch einfach umgefallen, als er gerade allein im Zimmer war.
Typisch Mann, lacht Susanna, dem ist der Schriftzug „war ich nicht“ von Geburt an gut lesbar auf die Stirn geschrieben, wie übrigens euch Zweibeinigen auch …
Ihr habt doch, fährt sie nach einer Weile fort, den Zeigefinger nur, um von euch weg auf den „wahren“ Schuldigen zu weisen.
Leider hast du recht, entgegne ich, da muß bei der Schöpfung etwas völlig danebengegangen sein.
Siehst du, lacht Susanna aufs Neue, statt dir die Kraft zu wünschen, dich zu bessern, gehst du aufs Ganze und schiebst die Schöpfung selber vors Loch – wenn die schief ging, kann Mann natürlich nichts machen …
Laß mich bitte einmal ausreden, sage ich, du weißt doch, was geschrieben steht: Der alte Adam hat sich – was übrigens so schwer nicht war – von Eva überreden lassen. Na und danach bemerken sie, daß sie nackt sind und verstecken sich. Aber der Schöpfer findet sie natürlich, weil das in seinem Plan so vorgesehen ist. Und er stellt die peinliche Frage, hast du etwa …??
Na, und was sagt dieser Tropf?!
Ja, ruft er, ja, ich habe! und es hat geschmeckt und ich wills immer wieder haben –
Hätte er jedenfalls rufen können. Stattdessen fährt er den Zeigefinger aus: Das Weib, das Du mir zugesellst hast …
Auf die Weise hat er gleich zwei Instanzen vor sich, die die Verantwortung übernehmen sollen. Kurioser Weise nennt er an erster Stelle „das Weib“, das beherrschen zu können er sich ja sonst anmaßt (hat „es“ mit der „Verführung“ also nur seinen eigenen Willen erfüllt?).
Gott aber schickte die beiden zum Arbeiten nach draußen, schloß die Türe zu und hatte endlich wieder seine Ruhe. Zufrieden schlenderte er durch seinen Garten und sah, daß es sehr gut war.
Ja – und seither haben wir das Problem mit dem Zeigefinger.
Susanna staunt. Schön gesagt – aber nun kommts drauf an, was du draus machst. Zum tausend und was weiß ich wievielten Mal gibt der Advent Gelegenheit zu einem Neuanfang.
Ich wage einen Scherz: Tausend und wieviel?? – der da oben muß eine Geduld haben …!
Abermals behält Susanna lachend das letzte Wort: Er?? fragt sie spitz – Sie!!!
Vom nahen Kirchturm klingt Glockengeläut herüber – und das erste Lichtlein brennt …
Thomas Gerlach