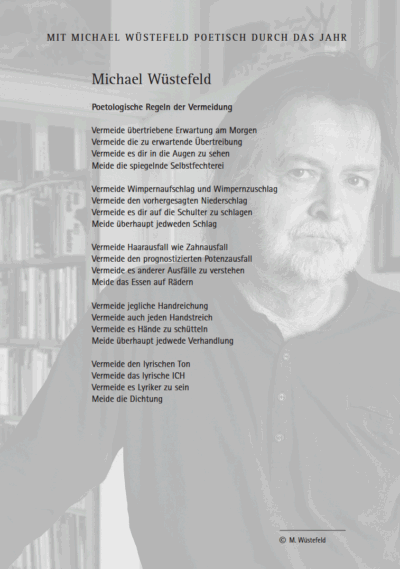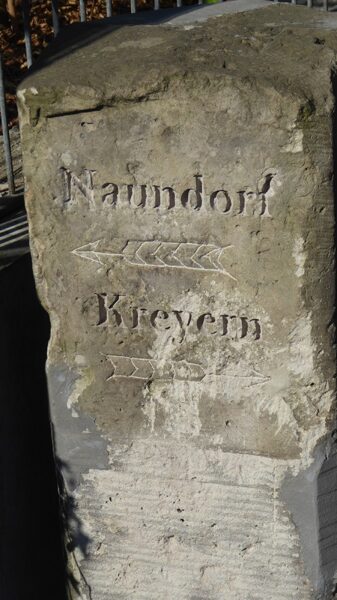28 Stationen, 100 Künstlerinnen und Künstler
28. und 29. Juni 2025
jeweils 13 bis 18 Uhr, Ausnahmen sind zu beachten
Nunmehr zum sechsten Male lädt die Radebeuler Veranstaltungsreihe „Kunst geht in Gärten“ kultursinnige Menschen dazu ein, sich auf eine Entdeckungsreise in Gärten und an besondere Orte der Lößnitzstadt zu begeben.
Maler, Grafiker, Fotografen und Kunsthandwerker präsentieren ihre Arbeiten im überraschenden Wechselspiel mit Natur, Kultur und Architektur. Wandernde Musiker sowie zahlreiche zusätzliche Begleitprogramme mit Kurzkonzerten, Puppenspiel, Lesungen, Performancedarbietungen, Schauvorführungen und Workshops bereichern das Angebot. Alle Mitwirkenden werden ihr Bestes geben und freuen sich auf interessierte Besucherinnen und Besucher.
Der Flyer mit dem vollständigen Programm, einem Orientierungsplan und zusätzlichen Hinweisenden ist in der Stadtverwaltung, in allen Kultureinrichtungen, Buchhandlungen und der Tourist-Information ab sofort erhältlich.
STATIONEN
1. Stadtgalerie Radebeul
Ausstellung FERMATA
10 Jahre Kunstspuren Radebeul
Im Garten:
SA 15 Uhr Actionpainting mit Klaus Liebscher
SA/SO 13-18 Uhr
Altkötzschenbroda 21
2. Kunsthof Altkötzschenbroda 23
Malerei, Glaskunst, Druckgrafik, Keramikobjekte
Simone Ghin, Markus Retzlaff, Sabine Herrmann
Schaudrucken, Hofcafé, Musik
SA/SO 13-18 Uhr
Altkötzschenbroda 23
3. Garten Gerlinde Queißer
Malerei, Grafik
Max Manfred Queißer
Ständig Kurzkonzerte
SA/SO 13-18 Uhr
Meißner Straße 247
4. KunstWerk Radebeul
Malerei, Zeichnung
Ausstellungen „Gegen das Vergessen“ und „Mein Garten“,
Workshop „Blumen die nie verblüh’n“
Bar, Musik, Liegewiese
Nur SA 13-18 Uhr!
Bahnhofstraße 18
5. Garten an der Naundorfer Heimatstube
Skulptur, Fotografie
Kai Nitzsche, Frank Damme
Schauvorführungen Spinnen, Klöppeln u.v.m.
Patchworkgruppe Große
Naundorfer Heimatstube offen!
Kaffee, Kuchen, Snacks, Wein u.a.
SA/SO 13-18 Uhr
Fabrikstraße 60
6. Kunstscheune Altnaundorf
In der Kunstscheune:
Malerei
„Himmel, Steine, Stroh und Wein“
Mechthild Mansel, Matthias Kistmacher
Im Kunststall:
Schüler der Malgruppe Mansel
Kunstautomat Atelier „FARBIG“
Musik, Schautöpfern, Snacks und Getränken
SA/SO 13-18 Uhr
Altnaundorf 6
7. Garten Fliesen Ehrlich
Malerei
Anna Ameno, Leonore Adler
SA/SO 13-18 Uhr
Meißner Straße 373
8. Garten „Jardin sans arrosage“
Malerei/Grafik, Illustration, Fotografie
Annette von Bodecker, Frank K. Richter-Hoffmann
SA/SO 13-18 Uhr
Mittlere Bergstraße 51
9. Besenwirtschaft Genussbutze
Malerei
Frank-Ole Haake, Edna Ressel
SA/SO 13-18 Uhr
Zechsteinweg
10. Garten Familie Schulze
Grafik, Skulpturen, Machwerke und Fotos
Petra Schulze, Horst Schulze
Rahmenprogramm mit Musik
Workshop „Jeder Mensch ist ein Künstler“
Kaffee, Kuchen, Getränke
SA/SO 13-18 Uhr
Am Talkenberger Hof
11. Garten Rosemarie Junker
Malerei, Keramik
Gruppe „Blaues Haus“:
Peter PIT Müller, Britta Berninger, Andrea Franke, Rosemarie Junker, Isabel Kopatz, Claudia Thieme
Rahmenprogramm mit Musik
Imbiss und Getränke
Prof. Wilhelm-Ring 28b
12. Kunsthaus Kötzschenbroda
Motto „Schattenspender, Lückenbüßer“
Bilder, Objekte, Installationen
Bernd Hanke, Matthias Kistmacher, Matthias Kratschmer, Christiane Latendorf, Anita Rempe, Gerald Risch, Heidrun Rueda, Gabriele Schindler, Moritz Jason Wippermann, Nele Wippermann
SA/SO 13-18 Uhr
Käthe-Kollwitz-Straße 9
13. Garten Emmerling
Druckgrafik
Sigrun Anderßen
SA/SO 13-18 Uhr
Karl-Liebknecht-Straße 2c
14. Garten Familie Alberich
Malerei, Skulptur, Fotografie
Silvia Ibach, Lucas Oertel, Jens Gebhardt, Sylvia Preißler
SA/SO 13-18 Uhr
Karl-Liebknecht-Straße 8b
15. Garten Johanna Mittag
Malerei, Objekte, Goldschmiedearbeiten
Johanna Mittag, Wieland Richter, Elena Mittag
Rahmenprogramm mit Musik
Kaffee, Kuchen, Wein und mehr
SA/SO 13-18 Uhr
Bodelschwinghstraße 1
16. Garten und Weingut JWD
Malerei, Fotografik
Friedrich Porsdorf, Bernd Hanke
Rahmenprogramm mit Musik und Lesung
SA/SO 13-18 Uhr
Obere Bergstraße 72
17. Weingut Förster
Malerei
Mandy Friedrich
SA/SO 13-18 Uhr
Obere Burgstraße 21
18. Garten Renate Kern
Malerei, Grafik, Aquarelle, Keramik
Anke Kern, Renate Winkler, Anne Klose,
Steffen Gröbner nur SA
Dorothee Kuhbandner nur SO
SA/SO 15.00 – 15.30 Uhr: Rakubrand
SA/SO 13-18 Uhr
Humboldtstraße 6
19. Garten Familie Schöne
Aquarelle, Emaillebilder auf Kupfer, Fotografie
Liselotte Finke-Poser, Günter Gläser, Gabriele Seitz
SA/SO 13-18 Uhr
Karl-Liebknecht-Str. 40
20. Garten Familie Miksch
Grafik, Malerei, Fotografie
Steffen Gröbner, Rita Stepanek, Michael Klose
Nur SO 13 – 18 Uhr!
Heinrich-Zille Straße 52
21. Garten Langer
Malerei
Sylvia Graumüller
Kuchen, Getränke
Nur SO 13 – 18 Uhr!
Dr. Külz-Straße 16
22. Sächsisches Weinbaumuseum Hoflößnitz
Fotografie
„Hörst du die Stille atmen?“
Gabriele Seitz
SA/SO 13-18 Uhr
Knohllweg 37
23. Garten Familie Scherf
Malerei
Jochen Rohde
Buchkunst
Heike Herzog (nur SA)
Kleines Imbissangebot, Wein
SA/SO 13-18 Uhr
Eduard-Bilz-Straße 51d
24. Hotel Villa Sorgenfrei
Malerei, Grafik, Keramik
Mechthild Mansel
Nur SO 13 – 18 Uhr!
Augustusweg 48
25. Garten Familie Nagy
Ölmalerei, Aquarelle, Bildhauerei
Ferenc Nagy, Marion Nagy, Peter Fiedler
Rahmenprogramm mit Lesungen und Musik,
sowie Malen für Kinder,
Kaffee, Kuchen, kalte Getränke
SA/SO 13-18 Uhr
Augustusweg 103e
26. HellerKunstRaum
Malerei, Grafik, Skulpturen, Objekte
Beate Bilkenroth, Kai Robert Kluge, Rita Richter, Ines Westenhöfer.
Rahmenprogramm mit Musik
SA/SO 13-18 Uhr
Hellerstraße 22
27. Garten Martina Beyer
Bildhauerei, Grafik
Martina Beyer
Kaffee, Kuchen, Wein
SA/SO 13-18 Uhr
Straße des Friedens 53a
28. Garten Ralf Uhlig
Ölarbeiten, Druckgrafik, Aquarelle
Ralf Uhlig
SA/SO 13-18 Uhr
Straße des Friedens 49
Hinweise
Bitte das eigene Glas und eventuell das eigene Picknickkörbchen mitbringen. Getränke sind vor Ort erhältlich. Bei starkem Regen können Ausstellungen und Aktionen ausfallen.
Eintritt frei. Änderungen vorbehalten!
Projektleitung, Kontakt & Info
Alexander Lange/Magdalena Piper
Stadtgalerie Radebeul
0351 8311-600, -625, -626, -627
E-Mail: galerie@radebeul.de
www.radebeul.de/stadtgalerie