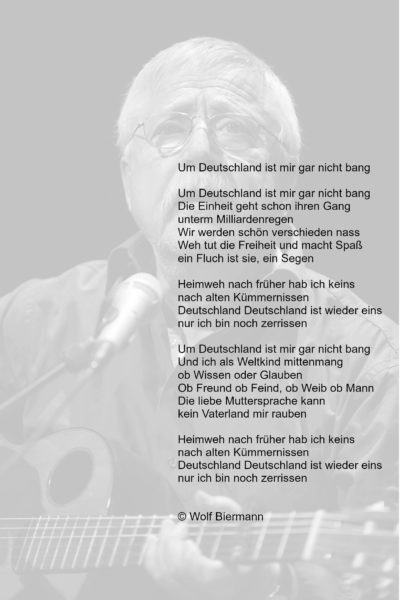Lessings „Minna von Barnhelm“ hatte am 18./19.1. Premiere an den Landesbühnen Sachsen
Obgleich Lessing insgesamt ein Dutzend Stücke für die Bühne schrieb, werden doch seit langem nur noch einige wenige davon regelmäßig gespielt. „Nathan der Weise“ (1783) natürlich, auch „Emilia Galotti“ (1772), gelegentlich noch „Miß Sara Sampson“ (1755) und „Minna von Barnhelm“ 1767). Was daran auffällt, sind die Titel: jeweils der Name der Hauptfigur wird direkt benannt. Was daran noch mehr auffallen sollte: In drei der vier Stücke stellte Lessing eine weibliche Figur in den Mittelpunkt, was in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein unerhörter Bruch mit den Traditionen war. Man gehe beispielsweise die Reihe der Shakespearschen Stücke durch: wo Namen im Titel auftauchen, geht es um Männer, allesamt Prinzen oder Könige. Dagegen Lessing, der Modernisierer, Vordenker und Aufklärer: Er wendete sich den Bürgern und dem niederen Adel zu, darunter besonders den Frauen. Minna von Barnhelm, sächsisches Edelfräulein, steht beispielsweise für eine selbstbewusste Frau, die sich nicht damit abfinden will, dass ihr Traum von einem Leben an der Seite eines verdienten preußischen Offiziers, Tellheim, an dessen Stolz und Ehrgefühl scheitern soll. Das ist die Grundkonstellation für das als Lustspiel deklarierte Stück, dessen vollständiger Titel bereits einen Fingerzeig auf den heiteren Charakter gibt: „Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück“.

Szene mit Grian Duesberg und Sandra Maria Huimann
Foto: Norbert Millauer
Unter der Regie von Steffen Pietsch entwickelt sich auf der von Katharina Lorenz geschickt und Ressourcen schonend eingerichteten Bühne (über die gesamte Spieldauer genügt eine als Wirtshauszimmer angedeutete Spielfläche mit Sofa, Koffer sowie Wand mit Tür) ein insbesondere im ersten Teil flottes und amüsantes Schauspiel, in dem das Regieteam den Akteuren viele Freiheiten lässt ihr komödiantisches Vermögen auszuleben. Dazu knallen Türen und purzeln Körper, wird auf Knien gerutscht und gerannt und werden Gegenstände hin- und hergeschleppt. Und zwar meist so, dass das Publikum ahnt oder gar vorab erkennt, welcher Trick aus der Kiste hervorzaubert wird. Hervorzuheben ist dabei in erster Linie Michael Berndt-Cananá, der einerseits als hinterlistiger, auf den eigenen Vorteil bedachter und liebedienerischer Gastwirt etliche Kabinettstückchen aus dem (körper-)sprachlichen Repertoire zaubert. Andererseits sorgt Cananás Auftritt im zweiten Teil als Riccaut de la Marlinière, einem französischen Militär, für den humoristischen Höhepunkt des ganzen Abends, wozu auch die famose Kostümierung (durch Katharina Lorenz besorgt) und seine Frisur beitragen. Aber auch andere Figuren wissen von Beginn an mit spritzigem Witz und einnehmender Agilität zu gefallen. Zu nennen ist da die in ihrer ersten Spielzeit im Ensemble eingesetzte Tammy Girke als Franziska, dem Kammermädchen der Barnhelm (Sandra Maria Huimann), die eine betörende Aura von Leichtigkeit und weiblicher Raffinesse umgibt. Oder auch Johannes Krobbach als Paul Werner, einem ehemaligen Wachtmeister im Regiment Tellheims, der es kaum erwarten kann, wieder in den Krieg (nach Persien) zu ziehen und der als liebevoll-ironisch gezeichnete Karikatur des soldatischen Gehabes daherkommt. Oder auch Moritz Gabriel als Tellheims Diener Just, der das Quartett der wichtigen Nebenfiguren komplettiert. Außerdem hat Anke Teickner noch einen kurzen Auftritt als Witwe eines ehemaligen Offiziers, der mit Tellheim im Felde gestanden war. Ob Zufall oder nicht, aber vor allem das genannte Quartett vermag es, die Sympathien des Publikums auf sich zu ziehen. Möglicherweise ist dieser Effekt aber auch der bewussten Entscheidung der Regie geschuldet, die Rolle der Nebenfiguren als „Spin Doctors“ zu betonen, die das Schicksal der Dame bzw. des Herrn beeinflussen. Die beiden Hauptfiguren, Minna und vor allem der Major Tellheim (Grian Duisberg) scheinen bisweilen mit angezogener Handbremse zu agieren. Das verwundert, denn eigentlich ist die Handlung vor allem um deren Beziehung gewebt, die zuerst durch Tellheims starren Trotz und danach durch Minnas ins Übermütige abkippender Lust an weiblicher List auf die Probe gestellt wird. Vor allem dadurch, dass der Teil nach der Pause weitgehend Minna und Tellheim gehört, schleichen sich einige Längen ein, lässt der Schwung des ersten Teils spürbar nach. Aber wenn ganz am Ende ein geseufztes „It’s a man’s world“ aus dem Off das Stück abrundet, wird doch noch einmal die Akzentuierung dieser Inszenierung deutlich: Eine verliebte Frau kann schon manches Mal über einen Mann den Kopf schütteln, aber viel lieber möchte sie ihm doch um den Hals fallen.
Alles in allem vermochte die Aufführung am Premierenabend dem Publikum, darunter erfreulich viele Schüler, im nahezu ausverkauften Saal etwas mehr als zwei vergnügliche Stunden zu bereiten und es davon zu überzeugen, dass auch ein Text aus dem 18. Jahrhundert frisch und kraftvoll daherkommen kann, ohne dass er sich an das Gegenwartsdeutsch anbiedern müsste.
Bertram Kazmirowski
Weitere Aufführungen in Radebeul: 7.3., 19.30 Uhr, 15.3., 19 Uhr.