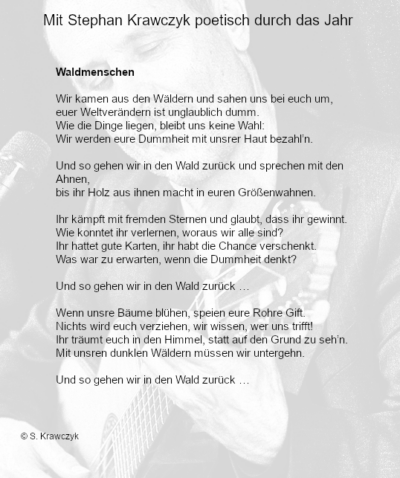Zur Premiere von „Maria Stuart“ an den Landesbühnen am 13. Januar
In den letzten Jahren, angesichts des Aufwinds populistischer und autokratischer Machthaber, wurde vermehrt die Frage gestellt, ob die Welt insgesamt eine bessere wäre, wenn es mehr Frauen in Regierungsverantwortung gäbe. Denn im Windschatten von Angela Merkel hatten sich seit 2017 vergleichsweise junge Frauen wie Jacinda Ardern (Neuseeland), Kaja Kallas (Estland), Mette Frederiksen (Dänemark) oder Sanna Marin (Finnland) an die Spitze ihres Landes gestellt und Politik plötzlich weiblicher als je zuvor gemacht – und jeweils auch nach außen hin sympathischer, freundlicher, kompromissbereiter. Sind Frauen per se also die besseren Machthaberinnen? Wer im Umfeld des Todes von Queen Elizabeth II. im Herbst 2022 jenseits aller Huldigungen auf die Zwischentöne gehört hatte, der wusste spätestens dann, dass die Antwort auf die Frage höchstens ein entschiedenes Jein sein kann, auch wenn die Unterschiede zwischen demokratisch gewählter Regierungschefin und Erbmonarchin natürlich gravierend sind. Aber ob nun Politikerin oder Königin, letztlich mussten und müssen alle gewählten oder gekrönten Häupter auf dem Spielbrett der Macht die Figuren zu setzen verstehen – und sich selbst zu bewegen wissen. Genau auf diesen zentralen Aspekt hebt auch Friedrich Schillers Drama „Maria Stuart“ (1800 veröffentlicht) ab und stellt uns mit Elisabeth (Julia Vincze in einer ihrer größten Rollen an den Landesbühnen) und ihrer Gegenspielerin Maria Stuart (Karoline Günst in ihrer zweiten Spielzeit am Haus in einer Paraderolle) zwei Frauen vor, deren Rang und Einfluss auf die Zeitläufte sich wechselseitig bedingen und ausschließen. Auch wenn erfreulicherweise weder die Inszenierung an sich (Manuel Schöbel) noch das Programmheft explizit einen Bezug zur Gegenwart herstellen – lassen wir ein Tablet als Kamera und digitalen Notizblock einmal beiseite –, so beantwortet der durch Regie und Bühne/Kostüm (Barbara Blaschke) brillant herausgearbeitete Konflikt zwischen Machtbesitz und persönlicher Freiheit die Frage nach dem Warum der Aufnahme des Stückes ins Repertoire. In diesem lässt sich nämlich exemplarisch beobachten und nachempfinden, mit welch unerbittlicher Schärfe das Ringen um Machtgewinn und Machterhalt einerseits und das Vorgehen gegen Machtverlust anderseits vonstattengehen kann und wie beides letztlich die zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Dazu bedient sich die Inszenierung bei der Gestaltung des Bühnenbildes eines genialen Tricks: Wohnt Maria als Gefangene in einem mittig platzierten, mit nach vorn aufklappbaren Seitenwänden versehenen Raum, der in seiner Ausmalung an ein mittelalterliches Gewölbe erinnert, so entsteigt im zweiten Akt Elisabeth einem ähnlich gebauten Quader, dessen Innenausstattung an einen gediegenen Saal erinnert. Diese Parallelität durchzieht das ganze Stück mit Ausnahme des 3. Aktes, der in einer Gartenlandschaft angesiedelt ist und das (historisch nicht belegte) Aufeinandertreffen beider Frauen zeigt. Mit steigender Spannung verfolgt das Publikum, wie beide Figuren Gefangene ihrer Rolle als tatsächliche (Elisabeth) und ambitionierte (Maria) Königin sind und sich den Einflüsterungen männlicher Ratgeber erwehren müssen. Elisabeth ist gezwungen, eine Entscheidung für oder gegen die Hinrichtung Marias zu treffen, weil diese, so glaubt man zu wissen, gegen Elisabeth putschen und den Thron besteigen will. Gleichzeitig ist sie Spielball der Interessen unterschiedlicher Kräfte, weshalb der Blick in die Herzkammer der Macht am englischen Königshof beklommen macht. Graf Leicester (Moritz Gabriel) ist erster Günstling der Regentin, aber heimlich auch immer noch in Maria verliebt und spinnt Intrigen, um seinen Kopf zu retten. Baron von Burleigh (Alexander Wulke) ist ein kompromissloser Machtpolitiker und fordert von Elisabeth eine ebenso kompromisslose Härte gegenüber Maria. Graf Shrewsbury (Boris Schwiebert) wiederum ist eher Taube als Falke und auf Ausgleich bedacht. Der Graf von Kent (Tom Hantschel) schließlich ist ein entscheidungsschwacher Ja-Sager. Zu allem Überfluss will der französische König sich mit Elisabeth vermählen, wie ihr durch den Gesandten Graf Aubespine (Grian Duesberg) überbracht wird. Maria geht es nicht viel besser: Zwar hat sie in Paulet (Matthias Avemarg) einen milden Aufpasser ihrer Gefangenschaft auf Schloss Fotheringhay, aber dessen Neffe Mortimer (Maximilian Bendl) will sie zur Flucht überreden und sie nach einem Mordanschlag auf Elisabeth mit Leicesters Hilfe auf den Thron hieven – um schließlich selbst als ihr Liebhaber davon zu profitieren. Der im Ganzen dreistündige Abend setzt nach der Pause zwei Höhepunkte in den beiden Szenen, in denen Elisabeth und Maria ganz bei sich sind und Freiheit und Macht jeweils ganz anders ausbuchstabieren. Was Julia Vincze und Karoline Günst in diesen Szenen abliefern ist großartig! Elisabeth, die als Königin die Freiheit haben müsste, souverän in allen Entscheidungen zu sein, will sich lieber die Freiheit nehmen, die Verantwortung am Tod Marias abzugeben. Maria dagegen, die Eingesperrte, schafft sich durch Gottesfürchtigkeit in Beichte und Eucharistie einen Raum absoluter Freiheit und geht selbstermächtigt und gesühnt dem Tod entgegen. Hier kehren sich in einem raffinierten dramatischen Kniff Macht und Ohnmacht in ihr jeweiliges Gegenteil um, weshalb ganz zum Schluss die mächtig-ohnmächtige Elisabeth ganz allein dasteht: Ihre Rivalin ist zwar tot, wird aber zur Märtyrerin, nachdem Falschaussagen wider sie entlarvt werden. An Elisabeth klebt das Blut ihrer Schwester. Auch wenn die beiden Hauptdarstellerinnen durch ihre schiere zeitliche Präsenz auf der Bühne das Stück maßgeblich prägen, so beruht die hohe Qualität der Inszenierung auf allen Akteuren, eingeschlossen auch Anke Teickner als Marias Amme und natürlich die Musiker (Berthold Brauer, Kevin Knödler, Simeon Hudlet), die viele Szenen und Umbauphasen behutsam instrumentieren und von Anfang bis Ende einen Klangfaden in Moll weben, zu dem am Anfang und Ende auch Maria beiträgt. Hervorzuheben sind auch die vielfältigen Ideen im Umfeld der Inszenierung, die das Publikum mit England und der Monarchie in Berührung bringen möchten. So konnte man sich im Glashaus des Foyers nicht nur an Tee und Gebäck bedienen und an einem Fotowettbewerb teilnehmen, sondern sich auch an einem Quiz zu den Soundtracks berühmter britischer Filme versuchen oder digital vermittelt Tom Hantschel lauschen, der aus erst kürzlich aufgetauchten Briefen der Maria Stuart liest. Leider wurden diese Angebote nur zurückhaltend wahrgenommen.
Vor fast 25 Jahren, im November 1998, hatte „Maria Stuart“ ihre letzte Premiere in Radebeul. Damals spielte eine Angela Merkel noch keine große Rolle in der Politik, die anderen zu Beginn gennannten Persönlichkeiten waren Jugendliche oder junge Erwachsene und wussten um die Fallstricke der Macht sicherlich wenig. Inzwischen dürfte sich das geändert haben. Schillers Text ermöglicht mit seiner „Maria Stuart“ jeder Generation eine Auseinandersetzung mit der Frage, welchen Preis man für Macht zahlen muss. Ob die Menschen in politischer Verantwortung daraus ihre Rückschlüsse ziehen, kann bezweifelt werden. Dieses Stück von Schiller zu lesen und frei von Selbstverwirklichungsallüren zu spielen lohnt aber immer wieder. Langer Applaus und mehrere Vorhänge rundeten einen beeindruckenden Theaterabend ab.
Bertram Kazmirowski
Nächste Vorstellungen: 2.2. 18 Uhr Radebeul; 3.2. 19.30 Uhr Meißen; 9.2. 20 Uhr Radebeul; 2.3. 19.30 Uhr Radebeul