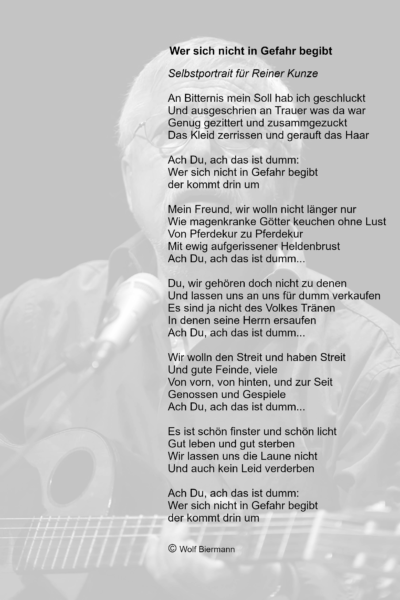Vorschauleser werden es wissen, von Zeit zu Zeit betrachte ich unsere Häuser hinsichtlich spezieller Details. Viele, die den gleichen Weg durch Radebeul gehen, werden an diesen Details vorübergehen. Die zuletzt behandelten Teile von Häusern waren die zapfenartigen Holzgebilde an Dachkanten von Schweizerhäusern (V&R 05/20).
Aber heute geht es um Eisernes, also Details vorwiegend aus Eisen bzw. Stahl bestehend, um ältere Fahnenstangenhalterungen für schräg auskragende Fahnenstangen an Fassaden, also fast verschwundene Relikte aus einer anderen Zeit. Meine Vorgabe war, nur wenn ich 5 Stück entdeckt hätte, lohnte es sich darüber zu schreiben. Da ich schließlich gar 6 eiserne Fahnenstangenhalter
gefunden habe, kann ich loslegen. Doch zunächst will ich das Thema größere, verzierte Fahnenstangenhalterungen in Radebeul abgrenzen, d.h., ich lasse die kleinen Blechhülsen meist für ganz kleine Fahnen an Fensterrahmen weg, ebenso jene Verankerungen für in Vorgärten oder im öffentlichen Bereich stehende senkrechte Fahnenstangen betrachte ich hier nicht. Natürlich fiel mir auf, dass von den 6 gefundenen Exemplaren sich 5 in Radebeul West befinden und nur eine in Ost. Habe ich in Radebeul-Ost vielleicht nicht gründlich genug gesucht? Oder sollte es eine andere Begründung für die ungleiche Verteilung geben? An welchen Haustypen können wir Fahnen oder Fahnenstangenhalterungen vermuten? Sicherlich eher an Häusern in Gebieten mit städtischer Entwicklung als in den Dörfern, also an öffentlichen Gebäuden wie Rathaus, Bahnhof, Postamt, Schule und Gasthof, auch an Wohn- und Geschäftshäusern und an Villen. Erstaunlicherweise wurde ich bei meiner Recherche gerade bei den öffentlichen Gebäuden überhaupt nicht fündig!
Die meisten Radebeuler Fahnenstangenhalter gehen auf die Zeit des deutschen Kaiserreichs, also die Zeit vor 1918 zurück und weisen eine gewisse künstlerische Gestaltung auf, die die Statik etwas in den Hintergrund schiebt. Ja, Statik muss bei solchen eisernen Konstruktionen auch beachtet werden, wenn man bedenkt, was für Kräfte bei Wind, Sturm und Regen auf die Fahne, die hölzerne Stange und die Halterung aus Eisen wirken und auf die Wand übertragen werden müssen. Die Geometrie eines Dreiecks steht für ein statisch bestimmtes, d.h., „gerade noch unbewegliches“ kräfteübertragendes System, und so können wir bei allen Fahnenstangenhalterungen Dreiecke in räumlicher Anordnung erkennen. Besonders da, wo die Fahnen über Straßen, Plätzen oder Fußwegen wehen muss die Statik stimmen, um darunter laufende oder fahrende Menschen nicht zu gefährden. Welche Arten von Fahnen könnten früher in den alten Halterungen gesteckt haben? Politische Fahnen sicher, wie die schwarz-weiß-rote Reichsflagge oder solche von Parteien, Fahnen von Vereinen oder auch der Werbung für größere Betriebe, z.B. Shell, Odol, oder für Geschäfte dienende Fahnen. Vermutlich gab es in Radebeul auch Fahnenstangen, die eine Seilvorrichtung hatten, um die Fahne zu hissen.
Wenn ich die Radebeuler Postkartenbücher (Schließer, Morzinek, Thiele) durchblättere, komme ich zu dem Schluss, es musste viel, viel mehr gegeben haben als jene 6, die ich heute noch fand. Vielleicht die zehnfache Menge. Ich sehe ein bekanntes Bild des Dresdner Maler Gotthard Kuehl „Blick vom Altmarkt zur Schlossstraße“ (Dresden um 1900) vor mir, wo in der Schlossstraße ein buntes Flaggenmeer zu sehen ist, da muss schon eine Begeisterung, ja Euphorie in der Bevölkerung gewesen sein. So wird einem auch klar, wo die Begeisterung einer Mehrzahl der Deutschen herkam, um 1914, später sprach man vom 1.Weltkrieg, in den Krieg zu ziehen. Wie ist das massenhafte Flaggen im Kaiserreich zu erklären und warum war in allen nachfolgenden deutschen Staatsgebilden diese Lust immer weniger geworden?
Im Land Sachsen zumindest sollte die grün-weiße Fahne zeigen, dass sich der letzte König Friedrich August einer gewissen Beliebtheit im Volke erfreuen durfte. In der DDR soll der ABV (Ortspolizist) Rundgänge gemacht haben, um zu prüfen, wer zum 1. Mai oder 7. Oktober nicht geflaggt hatte. Warum nahm der Bestand an Fahnenstangenhaltern über ca. 150 Jahre in Radebeul derart ab, dass ich heute nur noch 6 Stück davon auffinden konnte? Nach zwei verlorenen Kriegen ist den Deutschen offensichtlich die Lust Flagge zu zeigen vergangen, dann brauchte man auch keine Fahnenstangenhalter mehr. Hinzu kam, dass es oft der Rat von Handwerkern, Putzer und Maler war, das in der glatten Wand störende eiserne Ding doch abzunehmen, dann wäre der Preis etwas günstiger. Und ein paar von diesen Halterungen mögen auch durch Nichtbenutzung und fehlende Instandhaltung verrostet und herabgefallen sein – der Gang der Dinge, wenn man nichts macht. Doch schauen wir uns im Folgenden die verbliebenen 6 Fahnenstangenhalter einmal der Reihe nach (von Ost nach West) etwas genauer an:
1. Eduard-Bilz-Straße 23 (Mietvilla 1906, Fa. Gebr. Ziller)

Foto: D. Lohse
Die auf den ersten Blick einteilig wirkende eiserne Halterung der Fahnenstange unter einem Fenster des 1. OG besteht aus mehreren verschraubten Teilen, die relativ lange, schräge Rohrhülse (ca. 0,75m lang) sitzt am Fußpunkt auf einem senkrechten Grundblech auf und ist oben noch einmal horizontal mit einer Strebe (ca. 0,25m lang) wieder mit dem Grundblech verbunden, so wird ein Dreieck gebildet. Die Hülse ist außerdem nach beiden Seiten mit wellenförmigen Streben gegen das Mauerwerk abgestützt. Das Grundblech ist am oberen und unteren Ende in geschweifte Formen gespreizt und im Dreieck unter der Hülse finden wir noch eine schneckenförmige Metallzier. Diese Halterung erinnert an den Jugendstil und dürfte ursprünglich sein, lediglich die Schraubverbindungen irritieren hier ein wenig. Die Aufarbeitung und Verzinkung veranlasste in den 90er Jahren noch der Alteigentümer. Der jetzige Eigentümer hisst noch gelegentlich eine Fahne, zuletzt die italienische für ein da der Familie geborenes Kind – eine nette Idee!
2. Zillerstraße 10 („Landhaus Käthe“ um 1880, Gebr. Ziller)

Foto: D. Lohse
Am Hauptgiebel befindet sich in der Höhe der Decke des 1. OG eine eiserne, wohl ursprüngliche Fahnenstangen-halterung. Herr Dr. Franke, der heutige Eigentümer, bestätigte das Vorhandensein der Halterung zumindest seit Mitte der 20er Jahre als es seine Familie erwarb. Der obere Teil aus zwei ein Dreieck bildenden Stäben trägt an der Spitze (ca. 0,50m vor der Fassade) eine ringförmige Halterung. Eine Fahnenstange sah ich hier nicht. Auf den Stäben wurden oben und unten jeweils herzförmige, eiserne Zierelemente angebracht. Als Fußpunkt für die Fahnenstange finden wir eine Stahlhülse auf der Fensterverdachung aufsitzend. Die leicht verwitterten Metallteile haben eine dunkelgraue Farbe.
3. Zillerstraße 21 (Mietvilla von 1897)

Foto: D. Lohse
Die alte Fahnenstangenhalterung befindet sich hier zwischen zwei EG-Fenstern in einer vertikalen Achse zu zwei höher gelegenen Stuckrosetten. Nur der obere Teil einer ein Dreieck bildenden Metallkonstruktion, bestehend aus je drei geschweiften Metallbändern ist erhalten. An der Spitze der Konstruktion, ca. 0,60m vor der Wand, sehen wir eine Halbschale zur Aufnahme der ehemals vorhanden gewesenen Fahnenstange. An deren Vorderseite befindet sich eine kleine Metallrosette. Der untere Befestigungspunkt könnte auf dem Gesims in Höhe des EG-Fußbodens gelegen haben, ein entspr. Metallteil fehlt aber. Der Erhalt dieser Halterung war bei der Sanierung denkmalpflegerisch empfohlen worden. Die Metallteile wurden, wie der Zaun, mintgrün gestrichen.
4. Thomas-Mann-Straße 4 (Mietvilla 1895)

Foto: D. Lohse
Etwa in der Mittelachse der Schauseite des Hauses finden wir in Höhe zwischen EG und OG eine alte, zweiteilige Fahnenstangenhalterung. Der obere Teil besteht aus zwei ein Dreieck bildenden Stahlstäben mit gebogenen oberen Enden, wo ein Ring zur Aufnahme der Stange sitzt. Der Fußpunkt wird von zwei s-förmigen Bögen zwischen zwei EG-Fenstern gebildet. Offenbar existiert hier keine Fahnenstange mehr. Die Metallteile wurden schwarz gestrichen. Die gegenüber liegende Mietvilla könnte auch einmal eine Fahnenstangenhalterung besessen haben, woran lediglich zwei Metallösen in Höhe des 1. OG erinnern. (Da muss noch mal nachgefragt werden.)
5. Altkötzschenbroda 41 (Wohn- und Geschäftshaus 1877)

Foto: D. Lohse
Hier weht immer noch oder wieder eine Fahne über dem Fußweg in Höhe des 1. OG. Die zweiteilige Halterung besteht oben aus zwei ein Dreieck bildenden gedrehten Stahlstäben, auf denen jeweils vier kleine Zierbögen oben und unten, links und rechts aufgesetzt wurden, vorn eine ringförmige Halterung für die Holzstange. Wo die Stahlstäbe im Sandsteingewände zweier benachbarter Fenster verankert sind, wurden zwei rosettenartige Kappen aufgesetzt. Den Fußpunkt bildet eine flache Hülse auf dem Gurtgesims. Alle Metallteile wurden schwarz gestrichen. Die Werbefahne bezieht sich auf das im Hause befindliche Modegeschäft von Frau Fine Reiff.
6. Moritzburger Straße 1 (Wohn- und Geschäftshaus „Wettin-Haus“, 1898)

Foto: D. Lohse
Eine Werbefahne für die im Hause befindliche Bank befindet sich über dem Fußweg auf der Gebäudeecke am Erker in Höhe des 1. OG, sehr werbewirksam! Eine Postkarte aus den 30er Jahren (darauf auch ein moderner Hechtwagen der Straßenbahn) zeigt hier jedoch keine Fahne, so dass die Konstruktion einer vergleichsweise simplen Fahnenstangenhalterung wohl erst in den 90er Jahren angebracht worden sein kann. Zwei eiserne Zugstangen, deren Enden im Gewände des Erkerfensters verankert sind, bilden ein Dreieck und treffen sich in einem Ring, in dem die hölzerne Stange gehalten wird. Den Fußpunkt bildet eine Metallhülse, die passend in ein kreisrundes, älteres Stuckelement eingesetzt wurde. Hier ist sozusagen „Statik pur“ zu sehen. Verzierungen finden wir an der schwarz gestrichenen Fahnenstangenhalterung keine.
Das war wieder mal ein sehr spezielles Kapitel zum Bauwesen mit dem zu häufig vorkommenden Zungenbrecher „Fahnenstangenhalterung“, ließ sich aber kaum vermeiden. Da sind doch die Themen von meinem Redaktionskollegen K.U. Baum, alias Motzi, schon bewegender, wenn auch nicht weltbewegend. Ich kümmere mich eben gern mal um die stilleren Radebeuler Themen, vielleicht interessiert es ein oder zwei Leser? Ich danke Herrn Dr. Richter, einem ehemaligen Assistenten aus Studienzeiten, für ein anregendes Gespräch über Statik.
Dietrich Lohse