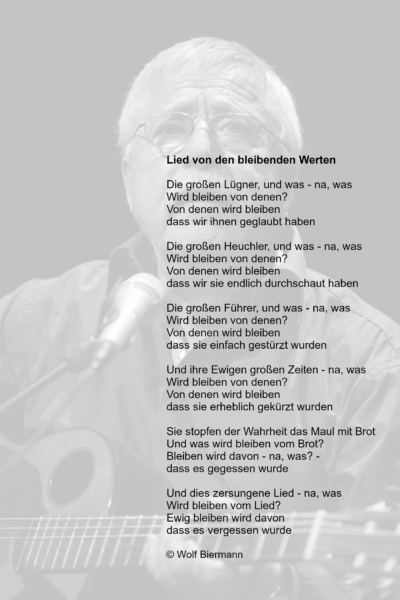-
Themen
-
Monatsarchiv
-
Links
-
Views
- Gedanken zu „Bittere Fragen – Villa Heimburg“, Borstrasse 15 - 42.473 Aufrufe
- Was uns Häusernamen sagen können (Teil 1) - 21.605 Aufrufe
- Karl Kröner zum 125. Geburtstag - 18.621 Aufrufe
- Im Archiv gestöbert: Von Ratibor nach Radebeul – Theodor Lobe - 16.985 Aufrufe
- Das historische Porträt: Johann Peter Hundeiker (1751-1836) - 16.053 Aufrufe
- Sommerabend in der »Villa Sommer« – ein Rückblick - 15.900 Aufrufe
- Im Archiv gestöbert: Das Landhaus Kolbe in Radebeul - 15.170 Aufrufe
- Das Weingut »Hofmannsberg« - 15.005 Aufrufe
- Laudationes - 14.900 Aufrufe
- Werke von Gussy Hippold-Ahnert wieder in Radebeul - 12.734 Aufrufe
Mit Wolf Biermann poetisch und politisch durch das Jahr
Do., 1. Okt.. 2020 – 00:12
Zur Titelbildserie
Do., 1. Okt.. 2020 – 00:10
Die Tuschezeichnung von Bärbel Kuntsche ist erst vor wenigen Tagen entstanden. Sie zeigt eine baumgesäumte Allee, welche auf ein repräsentatives Gebäude zuführt. Obwohl nur dessen Mittelteil mit dem markanten Turmaufbau und dem vorgelagerten Portal zu sehen ist, erkennt der Kundige sofort, dass es sich hierbei um „Haus Sorgefrei“ in der Oberlößnitz handelt.
Das einstige Herrenhaus wurde für den Dresdner Bankier und Freiherrn Christian Friedrich von Gregory (1757 – 1834) nach Plänen des Architekten Johann August Giesel (1751 – 1822) im spätbarocken Zopfstil errichtet. Danach wechselte das weitläufige Anwesen mehrfach seinen Besitzer. Oftmals forderten fehlende finanzielle Mittel ihren Tribut. Die Spuren des einstigen Verfalls sind heute getilgt. Das Haupthaus des Gebäudeensembles wird als Landhotel und der Gartensaal als Restaurant genutzt.
Ganz bewusst wählte Bärbel Kuntsche für ihre Zeichnung eine Frontalansicht aus der Distanz, so wie sie sich dem Spaziergänger vom Augustusweg her bietet. Weitergehen oder nähertreten – beides ist möglich.
Maler, Dichter, Fotografen, Historiker und Denkmalpfleger wurden immer wieder von diesem besonderen Ort inspiriert. Entstanden sind sehr individuell geprägte Bilder und Texte.
Auch der Schriftsteller Heinz Czechowski (1935 – 2009) bewahrte Vergangenes vor dem Vergessen in einem wunderbaren Essay aus dem Jahr 1974 über „Haus Sorgenfrei“ und seine einstigen Bewohner, das Malerpaar Gussy Hippold-Ahnert (1910 – 2003) und Erhard Hippold (1909 – 1972). Weitergehen oder nähertreten – beides ist möglich.
Karin (Gerhardt) Baum
Editorial Oktober 2020
Do., 1. Okt.. 2020 – 00:08
Das Jahr neigt sich dem Ende. Was für ein Jahr! Eines, das noch lange im sprichwörtlich kollektiven Bewusstsein verankert bleiben wird. Ein jeder wird von dieser Zeit seine Geschichten erzählen können.
Im Frühjahr hoffte man noch, mit der harten Zäsur bald alles überstanden zu haben, nun, ein halbes Jahr später schwören die Medien uns auf weitere noch unübersichtliche Herausforderungen ein. Gerade jetzt, wo Begegnungen und Kunstereignisse zaghaft geprobt werden.
Als Kulturzeitschrift mussten wir besonders erfahren, wie die Restriktionen das Leben dieser kulturbegeisterten Stadt in die Knie zwang und unserem Heft leere Seiten drohten. Und ja, es gleicht fast einem Wunder, dass wir die „Vorschau“ bisher dennoch gut gefüllt durch das Jahr bringen konnten. So sei an dieser Stelle allen Autoren besonders gedankt, die sich mit Ideen, Gedanken und Tatkraft einbrachten.
Wenn man den vorangegangenen Monaten etwas Positives (selbst dieses Wort wirkt jetzt euphemistisch) abgewinnen möchte, dann die ungeahnte Kreativität, mit der räumlich und zeitlich verteilt kulturelle Begegnungsräume in den Stadtteilen geschaffen wurden. Durchaus lohnende, bereichernde Impulse, die es so wohl nie gegeben hätte.
Die meisten Künstler und Händler haben bisher bewundernswertes Durchhaltevermögen und Willen bewiesen. Es bleibt ihnen zu wünschen, dass die gewohnt umsatzstarken Monate bis zum Jahresausklang die aufgelaufenen Einbußen auf ein erträgliches Maß kompensieren mögen.
Sascha Graedtke
Radebeuler Miniaturen
Do., 1. Okt.. 2020 – 00:07
Schweigen im Walde
(für T.)
Ein Regen nach langer Dürre: ein Regen.
Der Wald atmet auf. Die Blätter weiten sich, es grünt das Grün, wies grüner nicht grünen kann. In nicht enden wollendem Rauschen rinnt das Wasser von Blatt zu Blatt, läuft es in Strömen die Stämme hinab und gibt der Erde ihr Teil und den Büschen und Gräsern. Und dann, in der plötzlich zurückehrenden Stille steigt der Wohlgeruch frischen Wassers vom Boden auf.
Ohne weiter auf die Blicke der Neugierigen zu achten, steigt Susanna aus dem Bade, aufrecht, stolz und schön. Und wie am ersten Tag tritt sie unters Blätterdach, das Schweigen zu atmen, das Schweigen im Walde. Die daraus wachsende Stille, weiß sie, ist ein Geschenk des Himmels.
Hinter einer Birke bemerkt sie das Einhorn, das versonnen lächelnd ein paar Blätter rupft, plötzlich aber zu zwei Pilzen erstarrt und sich unters Laub drückt. Unerhörtes geschieht: Ein Selbstgesprächler frequentiert den Waldweg. Ein flaches Kästchen waagerecht vorm Gesicht führend rekapituliert er offenbar die jüngste Beziehungskrise auf so eindringliche Weise, daß vom Einhorn bald nur noch ein moosgrüner Belag zu sehen ist: Ja, sag mal, was denkst du dir denn eigentlich, hallt es durch die Bäume, das ist doch wohl … also ich fasse es nicht … denke nur nicht … laß mich doch mal ausreden … Es wird laut im Wald, wenn Häusliches zwischen die Bäume gekippt wird … nun fang doch nicht schon wieder damit an … ja, ja, ich bin allein … allein, allein, allein … Alte Autoreifen oder Kühlschränke können nicht störender sein.
Langsam kehrt der Frieden zurück.
Das Einhorn versucht ein paar frisch ergrünte Blätter und Gräser, Susanna atmet tief die frische Waldluft. Doch schon hallt eine Gebrauchsanweisung vom Waldweg herüber. Ein Spätpubertierer, nicht viel jünger als der Selbstredner von eben, vertieft sich lautstark in ein Problem, das ein Partner vermutlich auf der Unterseite der Erdscheibe mit einem technischen Gerät hat: unten, ja, unten links… nee, warte mal, doch, unten links erscheint jetzt ein Batten, ja, ein Batten, da gehst du drauf, hasdu, gut, ja, auf den Batten, und dann Doppelklick, sag ich doch, Doppelklick … Der Rufer hat kein Kästchen vor sich in der Luft schweben, er hat weiße Stäbchen in den Ohren stecken, die ihn davor schützen, den Gesang der Vögel hören zu müssen. So hat er die Hände frei zum Gestikulieren… und dann geht da ein Fenster auf, ein Fenster, ja am Bildschirm nicht im Zimmer, das zieht doch … Die Stimme verklingt in der Ferne. Ein Mensch, denkt das Einhorn, wie stolz das klang. Susanna lächelt dazu, hat aber schon eine Mädchenstimme im Ohr, die ihrer besten oder allerbesten oder jedenfalls Freundin erzählt, was wieder mit der Mama, den Jungs, dem Papa, den blöden Lehrern, wieder den Jungs, dem kleinen Bruder, noch mal der Mama und abermals den Jungs … so los ist und was ich dir unbedingt noch erzählen muß.
Stolz und schön aber völlig ermattet steigt Susanna ohne auf die Blicke der Neugierigen zu achten am Abend ins Bad. Das Einhorn ist bei der vergeblichen Suche nach dem Schweigen im Walde verloren gegangen.
Thomas Gerlach
Leserzuschrift
Do., 1. Okt.. 2020 – 00:06
Sehr geehrte Redaktion,
herzlichen Glückwunsch zum Artikel von Ilona Rau zum „Farb-Anstrich“ des Gymnasiumsanbau
Luisenstift im Augustheft, denn der Begriff „Farbgestaltung“ ist hier wohl Fehl am Platze. Was sagen eigentlich die Lehrer und Schüler des Gymnasiums dazu? Sind sie eigentlich bei der Farbgestaltung einbezogen worden -wäre doch interessant gewesen und, wie ich finde berechtigt, denn schließlich ist es ja ihre Schule und sie müssen täglich den Anblick in Kauf nehmen. Ob „Kackbraun“ motivierend wirkt, wage ich zu bezweifeln.
Als meine Kinder noch Schulkinder waren, hatten sie oft (zu oft) einen Begriff im Munde, den der neue Gymnasiumsanbau überzeugend darstellt: „Scheiß Schule“,
Da muss ich leider beipflichten.
M.Fasold
Zum 55. Todestag des Malers Paul Wilhelm
Do., 1. Okt.. 2020 – 00:04
Friedhöfe sind aus historischer, sozialer und kultureller Sicht ein Spiegel unsere Gesellschaft. Sie erinnern an einstige Vorfahren und vermitteln Identität. Verdienstvolle Persönlichkeiten erfahren häufig mit der Erhaltung und Pflege ihrer Gräber durch die Gemeinde eine besondere Würdigung über Generationen hinweg.
Vor fünfundfünfzig Jahren verstarb am 23. Oktober 1965 der Radebeuler Maler Paul Wilhelm in seinem Haus Gradsteg 46. Beerdigt wurde er auf dem Johannesfriedhof in Naundorf/Zitzschewig. Neben Karl Kröner (1887–1972) und Karl Sinkwitz (1886–1933) galt Paul Wilhelm (1886–1965) in seiner Künstlergeneration als ein bedeutender Maler der Lößnitz. Zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 1956 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft der Stadt Radebeul verliehen und ab 1960 erhielt er eine Ehrenpension, die ihm in den letzten Lebensjahren das Arbeiten ohne fortwährende Sorgen um die Existenz ermöglichte. Postum erfolgte im Jahr 1967 die Umbenennung der Brühlstraße in Prof.-Wilhelm-Ring. Auch der sogenannte „Paul-Wilhelm-Flügel“ im Luthersaal der Radebeuler Friedenskirchgemeinde aus Wilhelmschen Besitz erinnert an den Künstler. Gemälde, Aquarelle und Grafiken von Paul Wilhelm befinden sich in zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen. Sowohl das Weingutmuseum Hoflößnitz als auch die Städtische Kunstsammlung Radebeul haben Arbeiten des Künstlers in ihrem Bestand. Umfassende Ausstellungen würdigten zu Lebzeiten als auch nach dem Tode in Radebeul sein
Schaffen, darunter im Jahr 1984 im Berg- und Lusthaus Hoflößnitz zusammen mit Werken von Karl Kröner. Personalausstellungen folgten 1986 zum 100. Geburtstag in der Kleinen Galerie Radebeul, 2011 zum 125. Geburtstag unter dem Titel „Das unvergänglich Schöne“ in der Stadtgalerie und 2015/2016 zum 50. Todestag mit Aquarellen aus der Sammlung von Gottfried Klitzsch in dessen privatem Anwesen.
Zu Paul Wilhelms bevorzugten Motiven zählten Lößnitzlandschaften, Blumenstillleben, Gartenstücke und immer wieder die Gattin Marion, welche dem damaligen Heimatmuseum Hoflößnitz zahlreiche Werke aus dem Nachlass des Künstlers als Schenkung übergab. Wenngleich Paul Wilhelm auch keine leiblichen Nachkommen hat, so ist die Verehrerschar seiner Kunst nicht unbeträchtlich. Es wäre erfreulich, wenn der kleine Text dazu anregt, des Radebeuler Künstlers und Ehrenbürgers, an seinem Todestag auf würdige Weise zu gedenken. Das beigefügte Foto zeigt den Zustand der Grabstätte am 21. September 2020.
Karin (Gerhardt) Baum
DIE HEILSGESCHICHTLICHE WINDROSE AUF DEM VORPLATZ DER NEUEN PETER PAULS-KIRCHE ZU COSWIG IN SACHSEN
Do., 1. Okt.. 2020 – 00:04
EIN EINZIGARTIGES KUNSTWERK (3.Teil)
Interpretation
Kunstwerke der Bildenden Kunst werden bestimmt durch ihre visuelle Gestaltung und ihren geistigen Inhalt. Beides erfüllt die „Heilsgeschichtliche Windrose“ in hervorragender Weise.
Die visuelle Gestaltung – konzentrische Kreisflächen mit einem hervorgehobenen Mittelpunkt, durch den zwei senkrecht aufeinander stehende Gerade verlaufen (die Himmelsrichtungen) – und Gerade, die von der Peripherie unter verschiedenen Winkeln auf den Mittelpunkt zulaufen, sind eine Bildidee, die das Werk in das Niveau der abstrakten konstruktiven Kunst der klassischen Moderne stellt.
Der Künstler Heinz Koop hat in der Steinsetzung seine Religionsphilosophie dargestellt: Gott ist das allgegenwärtige Zentrum – symbolisiert durch die zentrale Granitplatte, beschriftet mit Alpha und Omega. Gott umfasst das gesamte Universum – eingebunden durch die Himmelsrichtungen in den Nord-Süd- und den Ost-West-Leisten. Die konzentrische Anordnung der Pflasterung zeigt die Ausstrahlung der göttlichen Kraft. Im Zentrum ist die Pflasterung wohlgeordnet gesetzt, sie symbolisiert die unmittelbare Sphäre Gottes. Durch einen Ring aus Großsteinpflaster ist sie deutlich abgegrenzt von der sich außen anschließenden Pflasterung. Diese ist auch konzentrisch angeordnet, aber aus abgenutzten Steinen gesetzt mit scheinbar zufällig eingestreuten schwarzen Steinen, und sie lockert sich mit wachsendem Abstand vom Zentrum deutlich auf. Das ist das irdische Reich Gottes mit seinen schwarzen Schafen. Die radialen Leisten mit den Aufschriften heiliger Orte und Jahreszahlen zeigen, wo und wann das angesprochene Ereignis war, in welcher Schriftart es überliefert ist und aus welcher Himmelsrichtung die Informationen zu uns kommen.
Heinz Koop führt den Betrachter vom Portal der Neuen Coswiger Kirche an markanten Beispielen in die Historie des Glaubens bis zu den Anfängen. Das wird deutlich, ordnet man die Ereignisse nach fortlaufendem Alter:
Durch den Bau der Neuen Peter Pauls-Kirche 1903 erhält die Coswiger Kirchgemeinde ein Gotteshaus, das zeitgemäß modern ausgestattet ist.
Mit dem Beginn der Reformation 1517 in Wittenberg breitet sich in weiten Gebieten Deutschlands eine neue Religionsauffassung aus.
Durch den Bau der Alten Peter Pauls-Kirche in Coswig 1497 erhält der Ort eine eigene Kirchgemeinde, heute dokumentiert sie mit Teilen ihrer künstlerischen Ausstattung die vorlutherische Religionsauffassung.
Bau des Fuldaer Domes 751 n. Chr., das Kloster wird dem Papst direkt unterstellt, Fulda wird ein Zentrum in der Hierarchie der Kirche.
In Konstantinopel wird 360 n. Chr. unter Kaiser Konstantin dem Großen die erste Hagia Sophia als christliche Kirche errichtet.
In Rom wird 350 n. Chr., ebenfalls unter Kaiser Konstantin dem Großen, der 1. Petersdom als christliches Zentrum im weströmischen Reich errichtet.
Im Jahr 30 n. Chr. wird Jesus Christus in Jerusalem gekreuzigt. Seine Anhänger schließen sich als erste christliche Gemeinde zusammen.
König Salomo baut 955 v. Chr. in Jerusalem einen prachtvollen Tempel, der die
Gläubigen zusammenführt; Gott sichert den Gläubigen seine Unterstützung
zu.
Ur – 1700 v. Chr.: Gott schließt mit Abraham einen Vertrag. Das wird der Ursprung der jüdischen, christlichen und der mohammedanischen Religion.
Die radialen Leisten mit den Beschriftungen sind die Träger der Informationen über das religiöse Bemühen der Menschen. Sie kommen in dem Bild aus dem „irdischen Reich Gottes “ und führen zur „Sphäre Gottes“. Alle streben zu Gott – aber nur Jesus Christus und der Tempel zu Jerusalem mit seiner Ausstrahlung kommen von Gott und führen zu Gott. Nur diese zwei Leisten stoßen im Bildwerk durch den zentralen Kreis, der die Sphäre Gottes markiert, bis zum Zentrum, d.h. bis zu Gott, vor.
Mit der Auswahl der Heiligen Stätten und der Ereignisse trifft Heinz Koop Marksteine in der Geschichte der christlichen Religion. Jeweils wird auf Erreichtem aufgebaut und das Neue erfolgreich weitergeführt. Die materielle Darstellung vergegenständlicht für den Betrachter Ort, Zeit und Schrift. Durch die kluge Auswahl der beispielhaft genannten Ereignisse wird eindrucksvoll die Entwicklung des Weltbildes der christlichen Religion vermittelt. Heinz Koop hat mit der Gestaltung des Vorplatzes der Neuen Peter Pauls-Kirche zu Coswig ein Kunstwerk geschaffen, das mit Recht als einzigartig bezeichnet werden kann.
Nachwort
Heinz Koop hat sein Kunstwerk der evangelisch-lutherischen Peter Pauls-Kirchgemeinde Coswig gestiftet (3.). – Begleitet von seiner Gattin, hatte er sich den Platz für seine letzte Ruhe auf dem Friedhof an der Kirche in Brockwitz ausgesucht (2.). – Er starb 2005 und wurde an der von ihm erwählten Stelle beigesetzt. –
Sein Bildwerk war pünktlich zur Jahrhundertfeier der Neuen Peter Pauls-Kirche fertig. Es ist eine große Darstellung der Geschichte einer großen Religion, ein einzigartiges, sakrales Kunstwerk. Zu jedem Gottesdienst läuft die Gemeinde darüber, es wird kaum beachtet. Das Anbringen einer Erläuterungstafel wäre wünschenswert.
Brigitte & Siegfried Grunert
Am Bau des Vorplatzes waren beteiligt:
Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Coswig/Sachsen.
Gestaltung: Heinz Koop, Dipl.-Ing., Freier Architkt, BDA (geb. 1942, gest. 2005).
Architekt: Architektengruppe Koop und Singer. Dipl.-Ingenieure, Freie Architekten, BDA, Kötitzer Sraße 24, 01640 Coswig.
Übertragung der Inschrift „Ur“ in Keilschrift: Altertumswissenschaftler F. Weierhäuser u. K. Zand, Universität Göttingen (Brief vom 06. Okt. 2003), vermittelt durch Frau Pfarrerin Dipl.-Theoln. I. Schuster.
Ausführung der Bildhauerarbeiten: Handwerksmeister D. Vogt und Meister Herklotz, „Neidmühle,“ Talstraße 46, 01665 Roitzschen, Gemeinde Triebischtal.
Ausführung der Gartengestaltung: Garten- und Landschaftsbau Berthold & Strasser GmbH, Bonitzscher Str. 33, 01663 Meißen.
Quellen
2. Mündliche Mitteilungen von Frau Eva Koop, Witwe des Künstlers.
3. Mai, Hartmut: Alte und Neue Peter Pauls-Kirche Coswig. DKV-Kunstführer NR. 524. 2. überarbeitete Auflage 2015. ISBN 978-3-422.02419.9. Deutscher Kunstverlag GmbH München. www.deutscherkunstverlag.de
Der Arzneiprofessor von Haus Sorgenfrei
Do., 1. Okt.. 2020 – 00:03
In memoriam Prof. Dr. Robert Thren (04.05.1909 – 26.10.1995) zum 25. Todestag
…und wenn Sie in Lahr wiedermal eine Straße zu benennen hätten“. So oder ähnlich lautete mein Abspann eines freundlichen Mailverkehrs mit einem Beigeordneten der Stadt Lahr/Schwarzwald im Jahr 2014. Unter der imposanten Liste „Söhne und Töchter der Stadt“ tauchten bekannte Namen auf. Herr Sütterlin, Erfinder der nach ihm benannten Schrift, Felix Wankel, Entwickler des nach ihm geheißenen Motors u.a.. Einer aber fehlte, doch jetzt liest man ihn: Prof. Dr. Robert Thren, Biologe, Arzneimittelforscher, Hochschullehrer. Dort wurde er am 4. Mai 1909 geboren, besuchte das Badische Gymnasium, studierte später Naturwissenschaften in Heidelberg (Promotion) und Freiburg i.Br. Es folgten Stationen in Stuttgart, Halle/S. und schließlich Radebeul.
Diese Zeilen schreibe ich im August 2020 auf dem Balkon meines Hotels auf der Insel Kos. Hippokrates hat hier gelebt und gelehrt und mir schien das ein gutes Omen, mich biografisch und episodisch einem genialen Wissenschaftler zu nähern, der mit seiner Frau jahrzehntelang unter uns in Radebeul gelebt hat. Und das eher bescheiden und unauffällig.
Wikipedia mag ich nicht abschreiben, zumal dort ein Irrtum vorliegt. Threns „residierten“ nicht im Haus Sorgenfrei auf dem Augustusweg, sondern lebten im kleinen Gärtnerhaus daneben. Als Kind in den 1970er Jahren war ich dort zu Besuch und selbst da schien es mir eng zwischen all den Büchern und Schallplatten. Der Professor entspannte gerne vor seiner RFT-Musiktruhe und alles roch nach seiner Leidenschaft: Zigarre. Und er kochte gern, ging dafür in Klausur, niemand durfte in die Küche. Erst nach dem Essen. Nun, ein Koch wäscht nicht ab. Wenn es denn dran war, konnte er auch herrlich im breitesten Badisch fluchen, um sich dann wieder Büchern zu widmen. Herr Erler vom Stadtarchiv Radebeul war behilflich, ein Foto aus späten Jahren zu finden. Historische Aufnahmen hat es im Bildband GESCHICHTE DES ARZNEINMITTELWERKES DRESDEN aus dem Jahre 2002, in dem er in Forschung und Entwicklung in leitender Funktion tätig war. Auf Seite 44 sitzt er vor seinem Mikroskop, auf Seite 45 schreitet er stolz als Mitglied der AWD-Delegation im Mai 1959 eine Treppe in Prag empor, anlässlich eines Antibiotika-Symposiums. Erinnern wir uns, da waren durch Krieg, Nachkrieg und Kalten Krieg erst langsam Gespräche über die Grenzen wieder möglich.
Für mich als Laie liegt hier auch seine spektakuläre Leistung, das Penicillin über Nachkrieg und Embargo, quasi durch den Eisernen Vorhang in Radebeul ein zweites Mal zu erfinden und die Produktion für die SBZ/DDR und den Ostblock aufzubauen. Googelt man Penicillin bei Wikipedia, wird das nicht erwähnt. Natürlich ist der Umfang seiner Leistung in der Arzneimittelforschung wesentlich weitreichender. Prof. Thren wurde dafür hoch geehrt (Nationalpreis der DDR, Vaterländischer Verdienstorden etc….) Erwähnt sei noch seine umfangreiche Lehrtätigkeit an mehreren Universitäten und Hochschulen der DDR. Letztlich fiel ihm seine Lebensleistung noch spät privat vor die Füße. Selbst mit Erreichen des Rentenalters (65) ließen ihn die Behörden nicht in seine badische Heimat fahren. Kalter Krieg, solche Regeln galten weiland auch „drüben“. Er war als Geheimnisträger eingestuft und bekam erst mit 70 einen dunkelblauen DDR-Reisepass.
Seine Frau Margarete, gleicher Jahrgang, ebenfalls eine „Südi“ aus dem Stuttgarter Raum, die ihn um fast 12 Jahre überleben sollte, galt als Frohnatur. An der POS Oberlößnitz unterrichtete sie noch über die Rente (Frauen damals mit 60) hinaus Biologie, Chemie und Englisch. Beide nahmen am kulturellen Leben in Radebeul und Dresden dankbar teil und sammelten Bildende Kunst von Malern aus der Lößnitz. Dem Paar waren keine Kinder beschieden, weshalb sich Frau Thren umso achtsamer und mit liebenswürdiger Herzlichkeit gleich um mehrere Patenkinder kümmerte. Threns fanden ihren Frieden in der Gemeinschaftsurnenanlage des Heidefriedhofes. Beider Namen sind in eine Stele eingraviert. Wer sie finden will, mag sie dort suchen. Oder sich an sie erinnern.
Ach ja, wenn die Stadt Radebeul mal wieder eine Straße zu benennen hätte, es gäbe nicht bloß Dichter….
Tobias Märksch
Herzlichsten Dank meinem Cousin Joachim Schwarze für „Info&Atmo“.
Niederlößnitz, wohin gehst du?!
Do., 1. Okt.. 2020 – 00:03
Ist diese Zeichensetzung in der deutschen Sprache überhaupt zulässig – ein Fragezeichen und gleich darauf ein Ausrufezeichen? Ich denke ja, nämlich in den Fällen, wo es sich um eine Frage handelt, aber der Zeitpunkt, eine Frage zu stellen, fast schon zu spät ist.
Es ist ziemlich genau zwei Jahre her, dass ich in V&R 09/18 einen Artikel über Niederlößnitz geschrieben habe, der durchaus Anerkennung bei Lesern und Leserinnen gefunden hatte. Wenn ich da festgestellt habe, dass der städtebauliche Charakter dieses Stadtteils sich erfreulicherweise bis 2018 gut erhalten hat, relativ locker bebaut und gut durchgrünt ist, also fast wie eine Gartenstadt wirkt und dadurch auch liebens- und lebenswert ist, muss ich meine damals geäußerte Meinung wohl nun ändern. In diesen zwei Jahren haben in einem gedachten Umkreis von etwa 250m um den Rosa-Luxemburg-Platz auffällig viele Abbruchfirmen gut verdient, d.h., viele Wohnhäuser sind abgerissen worden. Und der eine, von vielen Anwohnern gewünschte Abbruch – die nicht mehr betriebene Kaufhalle am Rosa-Luxemburg-Platz – fand nicht statt! Dafür hat das neuerdings da betriebene Büro, das wahrscheinlich keiner der Anwohner braucht, eine tolle, nachts rot leuchtende Werbeanlage bekommen. Die hier entstandenen, bzw. entstehenden Neubauten sind, was den Entwurf betrifft, von unterschiedlicher Qualität und Größe, so dass sich das gewohnte Stadtbild von Niederlößnitz geändert hat und wohl weiter ändern wird. Die Abbrüche betreffen meines Wissens zwar keine Kulturdenkmale – aber wenn denn, mal hypothetisch gesprochen, nur noch die Denkmale stehen blieben, wäre der Charakter von Niederlößnitz so auch nicht mehr zu retten. Die abgerissenen Wohnhäuser hatten ein Baualter von ca. 120 bis 150 Jahren und z.T. im Leerstand, aber keine Ruinen. Hätte man denn nicht mit gutem Willen auch ein paar sanieren, modernisieren und für neuzeitliches Wohnen herrichten können? Nein, es muss wohl immer etwas Neues sein!
Viele von diesen Grundstücken werden an Zugezogene oder Kapitalanleger, die vielleicht nie Radebeul sehen werden, verkauft und so entstehen hier Haustypen und Wohnideen, die in Niederlößnitz erst mal fremd und ungewohnt erscheinen. Aber von Zeit zu Zeit scheinen sich auch weit hergeholte Bautypen manchmal hier einzubürgern, ich denke nur an die Schweizerhäuser, die, zuerst argwöhnisch betrachtet, inzwischen ein Stück von Radebeul geworden sind. Man muss also vorsichtig sein mit einem allzu schnellen Urteil.
Und wie ist das mit den Gärten? Oft zielten die 800-1000m² großen alten Radebeuler Gärten mit Obstbäumen, einem Nussbaum, einer Linde, mit Obststräuchern, Gemüse, Flieder und ein paar Blumen auf weitestgehende Selbstversorgung und ein bisschen Erholung ab – heute ist das eher umgekehrt, nun wünscht man sich mehr Erholung. Da spielt dann bald auch Geld eine Rolle. Durch die relativ hohen Grundstückspreise, möchte in den meisten Fällen das, was man drauf baut, sich auch rechnen. An Stelle des älteren Landhauses, im Prinzip ein Einfamilienhaus, kommt ein reichlich doppelt so großer Neubau, zwei Häuser oder ein Doppelhaus. Wenn ein großes, altes Grundstück neu bebaut werden soll und die mögliche Größe des neuen Hauses allein über die einzuhaltenden Abstandsflächen errechnet wird, kommen dann Gebäude heraus, die die gewohnten Niederlößnitzer Verhältnisse sprengen. Und in den meisten Fällen ist die Mitwirkung von Maklern und Bauträgern von Nöten, die wollen ja schließlich auch noch was verdienen. Also ganz schlechte Zeiten für Buschbohnen, Radieschen, Astern und Co., das kriegt man doch im Supermarkt sowieso viel günstiger. Das ist nicht meine Art zu denken, aber sie ist doch schon recht weit verbreitet und erklärt zum Teil die aktuelle städtebauliche Entwicklung der Stadtteile Ober- und Niederlößnitz – der Charakter einer Villen- oder Gartenstadt verschwindet so zusehends.
Aber was kann man dagegen machen? Leider nicht viel. Man kann davon ausgehen, dass die entstehenden Neubauten alle eine Baugenehmigung von der Stadtverwaltung bekommen haben. Die wesentliche Rechtsgrundlage ist § 34 BauGB (Baugsetzbuch), ein „grobmaschiges Netz“ mit dem Ziel der Bauförderung. In der Stadtverwaltung werden gelegentlich B-Päne (Bebauungspläne) festgesetzt, die könnten aber nur kleinere Bereiche und nicht einen ganzen Stadtteil wie Niederlößnitz betreffen. Wenn man Baukultur, hier also die Erhaltung der Besiedlungsstruktur von Niederlößnitz, erreichen will, braucht man ein „feinmaschigeres Netz“, das neben o.g. § 34 zur Wirkung kommen muss. Das städtebauliche Instrument wäre eine Erhaltungssatzung, über die mit der Stadtverwaltung in diesem Jahr schon gesprochen wurde (Auslöser waren die Diskussionen und Zeitungsmeldungen zu zwei Neubauten in Oberlößnitz), ich weiß aber nicht, ob die Satzung schon da ist und angewendet werden kann. In den mittleren 90er Jahren gab es schon mal Bemühungen, eine solche Satzung zu beschließen, die Sache kam damals aber leider, wenn ich mich richtig erinnere, nicht durch die politischen Ausschüsse. Außer dem rechtlichen Hintergrund gehört natürlich noch dazu, dass die Mitarbeiter der Stadtplanung die jeweiligen Antragsteller beraten sollten, da kann man hinsichtlich Charakter und Einfügung eventuell auch noch was erreichen. Gäbe es da noch Reserven? Ich kann von hier aus also nur an die Fachleute der Bauaufsichtsbehörde und der Stadtplanung appellieren, bei neuen Bauanträgen alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die charmante städtebauliche Eigenart von Niederlößnitz besser zu erhalten. Aber wenn dann in manchen Fällen vom Antragsteller Anwälte hinzugezogen werden, werden die sich natürlich nur auf die § berufen, das mit dem „besonderen Charakter“ interessiert im Normalfall keinen Juristen, da gilt Kopf geht vor Bauch! Wahrscheinlich ist hier noch mit dem Entstehen von ein paar weiteren Neubauten in Ober- und Niederlößnitz zu rechnen, die bereits nach §34 geprüft und genehmigt worden sind, aber noch nicht begonnen wurden.
Welche Standorte von Abrissen und Neubauten in Niederlößnitz betrifft mein Nachdenken im Einzelnen? Borstraße 68 ( Abriss eines Landhauses der Firma Gebr. Große und dafür 2 Neubauten, die m.E. eine gute, moderne Gestaltung haben und sich relativ gut einfügen); Borstraße 52 (1 „Bellavista“-Neubau steht auf von Heinrichstr. 2A abgeteiltem Grundstück – das Problem hier, der leerstehende Altbau Heinrichstr. 2A wird durch den eigentlich guten Neubau erdrückt, was bei Nichtverkauf desselben auch früher oder später zum Abbruch führen wird); Dr.-Külz-Str. 5 (der kleine Altbau eines Landhauses hatte Denkmalverdacht, war es aber dann nicht geworden, nach Abbruch entsteht derzeit ein Neubau und ein zweiter muss gemäß der Absteckpfähle vermutet werden); Lößnitzstr. 2 (der Abbruch eines ortstypischen Landhauses ist erfolgt, 1 Mehrfamilien-Doppelhaus mit unpassender Dachform ist fast fertig, ein nicht so gutes Beispiel); Wilhelmstr. 9 (anstelle eines unauffälligen Altbaus steht ein inzwischen bezogener, moderner Neubau mit Flachdach, bei dem mir nur die teilweise Natursteinverkleidung zu auffällig erscheint); Winzerstr. 32 ( Abriss eines relativ großen Altbaus ist erfolgt, der noch nicht begonnene Neubau dürfte sicherlich größer werden).
Ich bin auch als ehemaliger Denkmalpfleger keineswegs ein Vertreter von denen, die sich für ihren Ort wünschen: “Käseglocke“ drüber und nichts geht mehr! Jede Zeit bringt neue Bauten hervor, das ist ein normaler Prozess, aber es sollte in einem bestehenden, für gut befundenen Stadtteil das richtige Maß und möglichst gute Gestaltung gesucht werden. Das Areal von Ober- und Niederlößnitz ist kein Brachland, wo man alles ausprobieren kann. Ja, die Überschrift betrifft Niederlößnitz, wenn ich an einigen Stellen Oberlößnitz mit einbeziehe, liegt das daran, dass die Geschichte und Besiedlungsstruktur der beiden Ortsteile sehr ähnlich ist und für beide mehrere B-Pläne oder eine Erhaltungssatzung vonnöten sind.
Dietrich Lohse
75 Jahre „Landesbühnen Sachsen“ und George Taboris „Mein Kampf“
Do., 1. Okt.. 2020 – 00:02
Ein Rückblick auf das Festwochenende am 19./20. September
„Gerade in unserer heutigen sehr rationalen Zeit, die geprägt ist durch gesellschaftliche Veränderungen, aber auch Krieg und Verbrechen, brauchen wir das Theater als einen Ort des Innehaltens, des Nachdenkens über unsere Geschichte und unsere Utopien. Theater als Möglichkeit der Sensibilisierung und des Ansprechens von Emotionen.“ Das, liebe Leser, ist kein Zitat aus einem der Grußworte oder Artikel, mit denen die pünktlich zum Jubiläum veröffentlichte Festschrift „75 Jahre Theater in Radebeul und Sachsen“ aufwartet, sondern eine Passage des Geleitwortes des (damaligen) Landesbühnen-Intendanten Christian Schmidt aus einer vergleichbaren Publikation, die 1995 anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Hauses veröffentlicht wurde. Es macht betroffen und verstört, dass 25 Jahre später
Schmidts Äußerung auch auf die Welt von heute zutrifft, obwohl er weder die Corona-Pandemie noch den Syrienkrieg und auch nicht die Flüchtlingskrise, Cyberkriminalität oder den wachsenden Einfluss des Populismus von Trump bis Johnson im Sinn gehabt haben konnte. Bestimmte Probleme und Krisen mögen kommen und dann wieder gehen, aber viele bleiben leider bestehen und manche anderen kommen dazu, weshalb es fortgesetzter und nachhaltiger kultureller Impulse braucht, die uns Menschen aufrütteln, nachdenklich stimmen und uns mit Hoffnung beseelt von einer besseren Zukunft träumen lassen. Deshalb „muss Theater sein“, wie ein in den 1990er Jahren verbreiteter Aufkleber des Deutschen Bühnenvereins richtigerweise proklamierte. Dass Theater wichtig ist, dass man nahe bei den Menschen und ihrem Leben sein muss, dass man nötigenfalls die Kultur zu ihnen quasi vor die Haustür zu bringen hat: diesem Anspruch, dieser Philosophie haben sich die Landesbühnen Sachsen seit ihrer Gründung im Sommer 1945 verschrieben. Unter dem Namen „Künstlerspielgemeinschaft Dresden-West/Volksoper Dresden“ feierte man am 25 August 1945, also nur gut drei Monate nach dem Ende des Krieges und als erstes Ensemble in Dresden, mit der Operette „Herz ist Trumpf“ im Gasthof Gittersee die erste Premiere. Fünf Jahre später dann, am 20. September 1950, wurde das Stammhaus in Radebeul bezogen und der ehemalige, zur „Goldenen Weintraube“ gehörige Tanzsaal als Spielstätte mit Webers „Freischütz“ eingeweiht. Schon Ende der 1940er Jahre, besonders aber Anfang der 1950er machten sich die Landesbühnen einen Namen als Reisetheater und bespielten etwa 80 Orte im Land Sachsen (bis 1952) bzw. danach in den Bezirken Dresden, Karl-Marx-Stadt, Leipzig und Cottbus.1 Und im Grunde genommen hat sich seither an der grundsätzlichen Ausrichtung des Fünf-Sparten-Hauses (Schauspiel, Musiktheater, Tanz, Figurentheater, Konzert – in Kooperation mit der Elblandphilharmonie) nichts geändert. Schaut man auf den Spielplan für den Monat Oktober 2020, dann entdeckt man neben vielen sehr unterschiedlichen Veranstaltungsformaten in Radebeul (von Oper bis Lesung) eben auch Gastspiele in einem Jugendklub in Hoyerswerda, im Theater Bad Elster und in einer Veranstaltungshalle in Neustadt/Sachsen. Es war und ist ein Markenzeichen der Landesbühnen, dass sie sich an die Bedingungen vor Ort anpasst und damit Zugänglich für alle Bevölkerungsschichten nicht nur räumlich ermöglicht. Viele Theaterinteressierte, nicht nur aus Radebeul und dem ländlichen Raum, sondern auch aus Dresden, schätzen die Landesbühnen seit Jahren für ihr ausgewogenes Repertoire und vor allem auch dafür, dass sich Selbstverwirklichungsprojekte (über-)ambitionierter Regisseure immer in Grenzen gehalten haben. Die Radebeuler Bühne mag nicht die Feuilletons von Frankfurter Allgemeine bis Süddeutsche Zeitung in Wallung versetzen, sie gewinnt keine publicityträchtigen Theaterpreise, man sieht zu den Premieren kaum Stars und Sternchen des Kulturbetriebs oder Politprominenz – aber das ist kein Mangel, sondern ein Zeichen für solide, bodenständige und nachhaltige Theaterarbeit. Dazu tragen die Akteure auf der Bühne und im Orchestergraben, von denen viele seit Jahren Sympathieträger beim treuen Publikum sind, ebenso bei wie die Menschen hinter den Kulissen: die Theatermaler und Schlosser, Beleuchter und Tontechniker, Kostümbildner und Fahrer, um nur einige Gruppen des nicht-künstlerischen Personals zu nennen, aber natürlich auch die Angestellten in den Büros von Intendanz bis Presseabteilung und im Besucherservice. Keiner sei von der Anerkennung ausgenommen: Liebe Landesbühnen, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, wie gut, dass es euch gibt! Möget ihr euch immer wieder neu erfinden und somit auch in Zukunft ein verlässlicher Anker für kulturelle Bildung und Unterhaltung für Radebeul und Umgebung sowie den ländlichen Raum in Sachsen bleiben! Die aktuelle Spielzeit mit insgesamt 26 (!) Premieren unter dem doppeldeutigen Motto „Über Mut“ (oder eben auch „Übermut“) kann dafür als Richtschnur dienen und macht neugierig auf die geplanten Neuproduktionen.
Eine davon eröffnete das Festwochenende und barg in sich auch gleich die Problematik des letzten halben Jahres: Ursprünglich terminiert für den 28. März war George Taboris Farce „Mein Kampf“ (1987) das erste Opfer des Corona-Lockdowns gewesen und kam nun folgerichtig zum frühestmöglichen Zeitpunkt unter gelockerten Pandemiebedingungen auf die Bühne. Den langjährigen Besuchern muteten die äußeren Umstände sicherlich ungewohnt an, denn auch die Landesbühnen müssen natürlich ein Hygienekonzept befolgen. Jeder Gast muss persönliche Angaben hinterlassen, und vor der Aufführung wird per Durchsage der Hinweis gegeben, wonach keinerlei Platztausch gestattet ist. Aber immerhin war der große Saal etwa zur Hälfte besetzt und Theateratmosphäre machte sich breit. Endlich – denn die Wartezeit seit der letzten großen Schauspielpremiere (Lessings „Minna von Barnhelm“ im Januar 2020) war mir doch schon sehr lang geworden! Taboris Stück (Inszenierung: Peter Dehler), das zum festen Bestandteil des Repertoires vieler deutschsprachiger Bühnen gehört und in dieser Spielzeit auch im Staatsschauspiel Dresden zu sehen ist, verlangt dem Publikum einiges ab. Dieses sollte vorbereitet zur Aufführung kommen, damit nicht falsche Schlüsse aus dem gezogen werden, was gezeigt wird. Denn man muss aushalten, einen zur Handlungszeit des Stückes (Wien 1907) noch unbekannten Adolf Hitler (Julia Rani mit dieser Rolle zu betrauen ist ein geschickter Schachzug, um Hitlers männlich kodiertes Weltbild zu dekonstruieren und damit lächerlich zu machen) auf der Bühne zu erleben, der von Weltherrschaft phantasiert und am liebsten alle nicht-arischen Menschen schrumpfen lassen möchte, um diese vom Rand seiner Welt in den Abgrund zu pusten. Man muss aushalten, dass der ungarische Jude Tabori (1914-2007), dessen Verwandtschaft zum überwiegenden Teil in Auschwitz ums Leben kam, in der Figur des Shlomo Herzl (Grian Duisberg verdiente sich zu Recht den größten Applaus) ausgerechnet einen Juden erfindet, der nicht nur Hitler mit freundlicher Offenheit begegnet, sondern ihn am Anfang dessen Wiener Zeit unterstützt, ihn mit Zuneigung zu einem besseren Menschen machen will und gar noch dafür sorgt, dass Hitlers Bart und Frisur zu dem werden, als die wir sie aus Bildern und Filmen vom historischen Hitler kennen. Hinzu kommt, dass Herzl verhindert, dass Frau Tod (Sandra Maria Huimann) Hitler holt, nachdem dieser an der Kunstakademie abgelehnt wurde und er sich aller Zukunft beraubt sieht. Ein Jude als Steigbügelhalter von Hitlers Aufstieg zum Weltzerstörer? Ja, genauso ist es. Hier versucht Kunst etwas einzufangen und im Spiel begreifbar zu machen, was in seiner monströsen Realität unbegreiflich war, ist und bleiben wird. Tabori bekannte einmal, dass er nach einer Erklärung dafür gesucht hatte, warum Hitler so wurde, wie er war. Taboris Ansatz: Hitler war als Kind nicht geliebt und auch als Erwachsener nicht liebesfähig und frei von Empathie. In dieser Grundkonstellation entfaltet sich das ungeheuerliche Spiel, das mit dem Entsetzen Scherz treibt. Herzls Freund Lobkowitz (Alexander Wulke) nennt Shlomos väterliches Kümmern eine „gefährliche Liebe“, und das wird sie in der Tat. Das Menschenschlachten wird im fünften und letzten Bild des Stückes durch Hitlers Helfer Himmlisch (Holger Uwe Thews gibt den kühlen Typus des Vollstreckers vor der Folie des historischen Heinrich Himmlers) symbolisch vorweggenommen, der genüsslich das Huhn Mizzi (Josepha Kersten) ausnimmt, während sich Hitler Frau Tod anschließt, um als deren Würgeengel der Welt fortan an die Kehle zu gehen. In dieser letzten Szene fällt die Düsternis des Geschehens mit der Düsternis der letzten Zeilen von Paul Celans „Todesfuge“ zusammen, die während der Übergänge zwischen den Akten aus dem Off eingesprochen wurde: „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland /dein goldenes Haar Margarethe“. Eine Margarethe hat auch dieses Stück zu bieten (Tammy Girke erinnert nicht nur durch ihre äußere Erscheinung an das Gretchen aus Goethes „Faust“ als den literarischen Archetypus jugendlicher Weiblichkeit der deutschen Literatur), die zwischen Liebe und Liebesverrat zu Shlomo schwankt. Anja Fuhrtmann legt die Bühne als an den Seiten durch zwei einfache Doppelstockbetten markierte Spielfläche an, deren hintere Begrenzung entfernt an das Brandenburger Tor erinnert: Spinde und Türen, als trügen sie ein Dach, darauf, statt der Quadriga, auf einem Podest der Musiker Tobias Herzz Hallbauer, der für passende musikalische Impulse zum Text sorgt.
Sehr anerkennender Schlussapplaus für eine knapp zweistündige, in Teilen spannende, jederzeit sehens- und hörenswerte Aufführung, an deren Ende die Akteure sichtlich erleichtert und glücklich den Vorhang sich schließen sahen. Nur wer selbst Künstler ist kann wohl ermessen, wie wichtig dieser Moment für das Ensemble war.
Bertram Kazmirowski
Nächste Vorstellung: 16.10., 20 Uhr, Stammhaus Radebeul