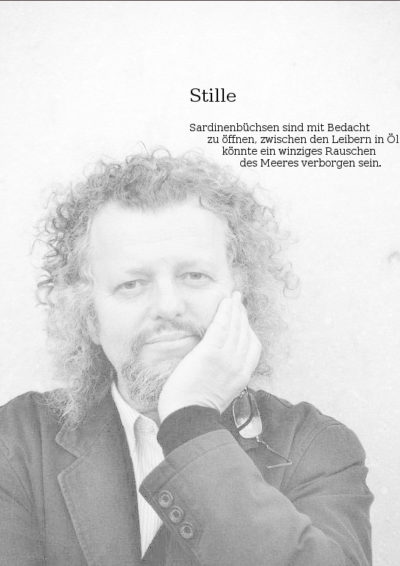Auszüge aus der Laudatio für Jens Kuhbandner
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Jens Kuhbandner, verehrte Gäste,
in einem an Höhepunkten reichen Jahr ist die Verleihung des Kunstpreises der Großen Kreisstadt Radebeul stets ein noch weiter herausragendes Ereignis. Mit dem Preis wird erneut ein besonderes Augenmerk auf Künstler und Kunst gelegt. Das scheint mir besonders wichtig in einer Zeit und in einem Land, in denen Kunst und Kultur nicht selbstverständlich sind, sondern – etwa durch Ernennung zum weichen Standortfaktor – einem steten Rechtfertigungsdruck unterliegen. Wichtig ist auch, dass – wie in der Satzung formuliert ist – Kunstförderer oder -organisatoren mit anerkannter Wirkung mit dem Preis gewürdigt werden.

Oberbürgermeister Bert Wendsche überreicht den Kunstpreis an Jens Kuhbandner
Bild: Jörg Kuhbandner
Verse, wie die aus Frank Zappas imaginärem Film Joe’s Garage, haben, so stelle ich mir vor, die jungen Leute um Jens Kuhbandner im Kopf gehabt, als sie vor reichlich fünfundzwanzig Jahren das Café Noteingang schufen. Der Name war Programm. Er bot denen ein Willkomm, die sich seelisch unbehaust fühlten. Andererseits konnten die jungen Leute, wie Jens es ausdrückte, die Anarchie genießen, die in jenen Jahren auf bis dato ungekannte und ungeahnte Weise Dinge möglich machte, die vorher und nachher unmöglich gewesen wären.
Der Ort, den sie entstehen ließen, war nämlich keineswegs dazu gedacht, mit der Bierflasche in der Hand und der Kippe im Mundwinkel einfach nur abzuhängen. Es gab ein zunehmend anspruchsvolles Programm, bei dem selbstverständlich die Musik im Mittelpunkt stand, denn MUSIK, wir hörten es, ist das BESTE! Es war getragen vom Gestaltungswillen seiner Macher, die sich selbst und anderen einfach das Leben auf kulturvolle Weise schön machen wollten. Anregungen dazu hatten sie schon beim Radebeuler Popsommer erhalten, als die Sporthalle an der Elbe für ein paar Jahre zur Tonhalle mutiert war. Musiker mit damals wie heute anerkannten Namen – denken wir an Louisiana Red, Joe Sachse oder Hansi Noack – gaben sich im Noteingang die Klinke in die Hand. Auch der spätere Betroffenheitslyriker Olaf Schubert fehlte nicht. Daneben gab es literarische Veranstaltungen, Lesungen und Buchvorstellungen, bald schon aus dem eigenen Repertoire.
Wie nachhaltig Noteingang wirkte und bis heute weiter wirkt, wird deutlich wenn wir uns klar machen, dass die sprichwörtliche familiäre Freundlichkeit des Kötzschenbrodaer Pubs Die Schmiede dort ihre Wurzeln hat und Michas Leibspeiserei ohne Noteingang nicht gedacht werden kann. Auch dass Eddi Kupfer im neuen Noteingang im Serkowitzer Weißen Haus eine Druckwerkstatt für junge Künstler offen hält und damit ein durch offizielles Desinteresse aufgerissenes Desiderat wenigstens ansatzweise ausgleicht, ist den Erfahrungen jener Jahre zu danken.
Von Anfang an waren der Name Noteingang und sein Programm untrennbar verbunden mit dem Namen Jens Kuhbandner oder Kubbel, wie die Eingeweihten ihn nannten und heute noch nennen.
Wer aber ist der stille Mann, der sich so eindrucksvoll Gehör zu verschaffen versteht? Wer der Zurückhaltende, der vorneweg geht? Der, 1969 in Radebeul geboren (damals ging das noch), an der EOS Juri Gagarin das Abitur ablegte und schließlich im Noteingang vom Zappaianer zum Veranstalter, Initiator und Organisator reifte, dem recht schnell der Beruf als Vereinsvorsitzender und Programmchef vom Noti wichtiger war als das begonnene Studium der Literaturwissenschaft?
Du bist, der du bist, und damit hat sichs, hatte Frank Zappa kategorisch festgelegt und lakonisch hinzugefügt, die Kuh hat keinen Schinken.
Auch Jens ist der, der er ist: unverstellt authentisch er selbst. Daraus zieht er die Kraft und den Mut, mit seinen Büchern und dem Label NOTschriftenverlag nach Frankfurt auf die Buchmesse zu reisen und Suhrkamp ins Gesicht zu lachen: Ich bin, der ich bin.
Es hatte mit zwei Bändchen begonnen, die Cornelia Lindner per Hand in Wellpappe gebunden hatte – mit Liebhaberexemplaren also. Das eine enthielt den schon erwähnten Traum vom Chef selber, das andere Gedichte von Edward Güldner. Vorangegangen war dem ein unbewusster Testballon mit Kuhbandnerschen Gedichten und Bildern von Eddi Kupfer: ein Fragmente dieser Tage genanntes Bändchen, das noch nichts vom späteren Erfolg ahnen ließ.
In weiser Voraussicht hat Peter Koch, unser virtuoser Cellist, ein paar Motive aus Smetanas Moldau in seine Improvisationen einfließen lassen – denn so, wie dort die Quelle zum Bach und der Bach zum Strome sich mausert, in aller Stille, aber unaufhaltsam breiter und fruchtbarer wird, bis er in getragener Ruhe dem Meere zustrebt, so wuchs auch das Verlagsangebot stetig und begeisternd auf bisher ca. 270 Titel von denen rund zwei Drittel noch lieferbar sind. Als Eigenanteil hat Jens sieben Bücher aus eigener Feder eingebracht, das Radebeul-Lesebuch initiiert und herausgegeben und zu drei Bänden die Fotos geliefert. In der Erzählung Konrad folgt der Autor den Spuren des Nibelungendichters, in Tandaradei verliebt sich Walther von der Vogelweide in ein Kötzschenbrodaer Hirtenmädchen. Beide Bände sind eine Reminiszenz an seine Studien der Literaturgeschichte, die ihn bis heute gefangen halten, auch wenn er sie nicht auf übliche Weise vollendete sondern stattdessen nicht nur zwei Blicke ins Leben wagte.
Als Verleger tritt Jens in vielen Fällen vor allem als Wunscherfüller auf, denn der Wille zum Buch ist nicht nur in ihm übermächtig, er grassiert geradezu unter uns, und nichts ist schöner, als den eigenen Band endlich in den Händen zu halten. Demgegenüber sieht er seine Rolle zunehmend auch als Kunstvermittler. Mit der von Günter Gerstmann in Jena angeregten Neuherausgabe der Gedichte und Tagebücher von Hanns Cibulka, der Herausgabe der stimmungsvollen Skizzenbücher von Thilo Hänsel, der Übernahme der Kataloge von Michael Hofmann und der Reihe der, wenigstens in Radebeul viel zu wenig beachteten, Aphorismen von Christian Uri Weber und nicht zuletzt mit der Edition des Lebenswerkes des Puppenspielers Gottfried Reinhard, um nur einige zu nennen, sind ihm wichtige Schritte zur Kunstvermittlung gelungen.
Für die Reihe Lesen in Kötzschenbroda konnte Jens sogar Franz Hohler nach Radebeul locken. Als Gründungsmitglied der IG Jazzgeflüster, die zwischen 2005 und 2007 zu monatlichen Veranstaltungen lud, hatte er zwischenzeitlich wieder seiner alten Liebe gehuldigt – schließlich heißt es nicht umsonst, MUSIK ist das BESTE.
An dieser Stelle aber muss Altmeister Zappa doch widersprochen werden:
Wirklich Das BESTE nämlich ist, dass wir nun den Kunstpreis der Großen Kreisstadt Radebeul an Jens Kuhbandner überreichen, an einen Mann also, ohne den die Kultur in der Stadt ein gutes Stück ärmer wäre, an einen Mann, dem immer wieder gelingt, was vielerorts nicht mehr für möglich gehalten wird und deshalb nur umso wichtiger ist: in schwierigen Zeiten positive Signale aus dem Elbtal heraus ins weite Land zu senden.
Und nun ganz zum Schluss noch einmal Frank Zappa: Okay. Das wars. Ende. (…) und vergessen Sie nicht, wählen zu gehen.
Thomas Gerlach