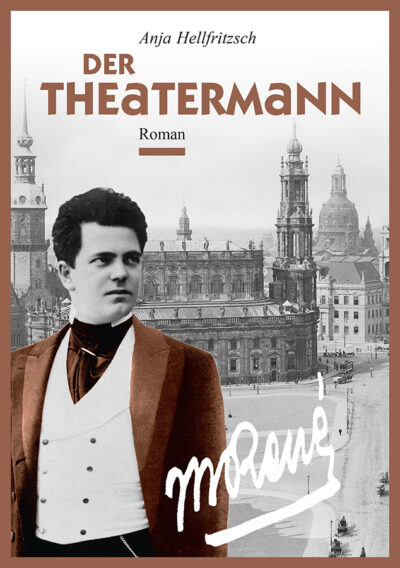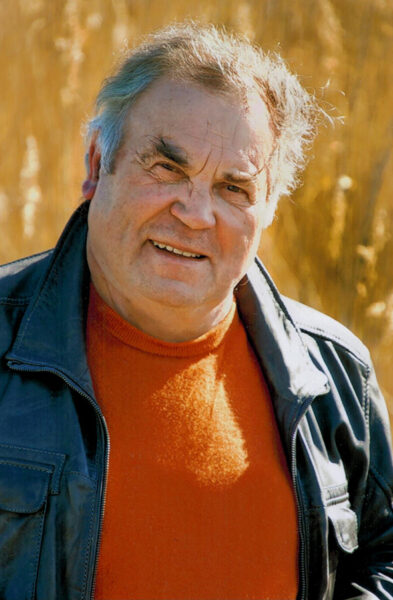„Rekonstruktion Putzschnitt Turnerweg 1 nach Hermann Glöckner“ 2021
2019 sind der Besitzer, Herr Herrmann (Firma Ventar Immobilien) des zum Wohnbau umgestalteten AWD Klubhauses und die Architektin Frau Kulke an mich mit dem Anliegen der Lösungssuche für die Wiederherstellung des unter Denkmalschutz stehenden Putzschnittes an mich herangetreten. Um ein schlüssiges Gesamtkonzept zu erstellen, habe ich wie am Gasthof Reichenberg auf die Zusammenarbeit mit den Kunstmalern, Grafikern und Restauratoren Reiner und Ekkehard Tischendorf gesetzt. Da es der Bauherr ablehnte, das neue Werk wieder fest verbunden im Mauerwerk direkt am Ort umzusetzen, haben wir nach einer Lösung für ein „Fertigteil“ suchen müssen. Allein die Größe des Putzschnittes mit 3,7 x 1 m war eine Herausforderung. Gefunden werden musste eine Lösung hinsichtlich der Trägerplatte und der künstlerischen Machbarkeit. Bezüglich der Platte hat sich eine Zusammenarbeit mit der TU Dresden, Institut für Baustoffe angeboten. So konnten wir eine Betonplatte entwickeln, die nur 3 cm dick ist und den umlaufenden Rand mit integriert. Durch diese Randverstärkung in der Optik des alten Putzrahmens und entsprechender Karbonfaserstab-Bewehrung haben wir genug Steifigkeit und damit auch Transportfähigkeit erreichen können. An dieser Stelle sei dem Team von Dr. Butler noch einmal herzlich gedankt!
So vergingen über die Vorplanung, den Bau eines universell einsetzbaren Spezial-Schalungstisches und die Verfeinerung des technologischen Ablaufes die Monate. Im April 2021 war es dann soweit und wir konnten die Platte betonieren und nach Wochen der Trocknungszeit und Nachbehandlung in unserer Halle transportieren und zum künstlerischen Teil übergehen. Die Platte wurde nun in Arbeitshöhe senkrecht aufgestellt und gesichert.
Letzte Abstimmungen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde in Großenhain konnten im Sinne absoluter Gegenseitigkeit erfolgen.
Durch die Dokumentation und Sicherung der „kläglichen Überreste“ des Originals durch die Restauratoren Gruner und Schmidt im Jahr 2010 konnten wir mit einiger Sicherheit in der künstlerischen Umsetzung der Rekonstruktion agieren. Denn so war zumindest der Aufbau der verschiedenfarbigen Putzlagen und der Duktus H. Glöckners nachvollziehbar. Unter anderem angedacht war auch ein zusammenpuzzeln wiederverwendbarer Teile und deren Integration in das neue Werk. Diese Idee musste aber aus Kostengründen verworfen werden. Die Teile hätten einer Entsalzung mit zweifelhaftem Ergebnis unterzogen werden müssen. Auch das erzielbare Gesamtergebnis war nicht klar kalkulierbar und damit nicht vermittelbar.
Vier Putzlagen und eine Haftbeschichtung auf dem Beton waren herzustellen. Haftschicht und Kalk-Zement-Unterputz bekamen genug Zeit, um zu abzubinden. Diese wurde in der Hauptsache durch die Herren Tischendorf genutzt, um die zeichnerische Vorlage und die Lochpause auf Spezialkarton anzufertigen. Mit einem weitgehend verzerrungsfreien Bild der deutschen Fotothek konnte die Genauigkeit verfeinert werden. Die nahezu perfekte Lochpausvorlage zu erstellen, wurde zum Geduldsspiel und kostete noch einmal Zeit und Nerven. Putz- und Farbproben wurden erstellt und die Entscheidung fiel für einen Werksmörtel der Firma Baumit.
Doch dann kam der große Tag und ab 5 Uhr morgens wurden die 3 farbig (Rot, Ocker, Sandfarben) eingestellten Putzlagen von je ca. 1 cm Dicke in freskaler Folge aufgetragen. Absolute Exaktheit in Putzdicke, Ebenheit, Oberfläche und passender Abfolge waren erforderlich und haben Zeit bis zum Mittag in Anspruch genommen. In altdeutscher Reibetechnik mit einem Holzbrett kommt die Oberfläche in ihrer Textur jetzt dem Original fast gleich. Gegen 15 Uhr war die Steifigkeit der Putzlagen groß genug, um die Lochpause auflegen zu können. Ganz traditionell mit Holzkohlepulver im Stoffsäckchen wurden die Konturen der Ornamentik auf den frischen Putz gepudert. Nun erschien schon einmal das Bild in voller Größe. Mit hoher Konzentration konnte nun entlang der Konturen geschnitten werden. Nach Vorlage jeweils bis in die obere oder bis in die mittlere Putzlage. Auf Schrägstellung der Kanten war zu achten und auf gewissenhaftes Abtragen der ausgeschnittenen Putze, sowie auf gleichmäßiges Strukturieren der verbliebenen tiefer in 2 Ebenen liegenden Oberflächen. Zwischendurch immer wieder Abgleich mit der Vorlage und den Originalteilen. Ein grober Fehlschnitt und alle Arbeit war umsonst! So war es dann Mitternacht, als der letzte Handgriff getan war. Reiner und Ekkehard Tischendorf freuten sich mit mir ganz still über das augenscheinlich gelungene Werk!
Tage der Nachbehandlung und Abbindezeit vergingen. In dieser Zeit fiel die Abstimmung mit dem Statiker des Bauherren zur Technologie der Befestigung am Objekt. Unser Vorschlag, mit starken Edelstahlwinkeln zu agieren fand Anklang und diese wurden dann vom Edelstahlbau Robert Rudolph gefertigt und gebohrt. Nach dem Gerüstbau am Einsatzort konnten die Stahlteile vormontiert werden. Aber waren die Teile und die Betonplatte wirklich im Gleichklang? Würde die Kranmontage auf Anhieb gelingen? Es wurde also noch einmal spannend. Genau wie der Transport aus unserer Halle in Coswig auf den Turnerweg in Radebeul Ost. Diesen Part hat die Firma Metallbau Große aus Kötzschenbroda übernommen und mit Bravour durchgeführt. Die Kranmontage am 16.07.2021 war ein voller Erfolg. Die Platte mit ihren 530 kg Gesamtgewicht nahm exakt ihren vorgesehenen Platz an historischer Stelle ein. Kleine Nacharbeiten am Betonrahmen und das Gerüst konnte abgebaut werden.
Gemeinsam mit Alexander Lange vom Kulturamt unserer Stadt konnten wir uns nun guten Gewissens ein Glas Sekt genehmigen!
Mein herzlicher Dank gilt all jenen, die an diesem Projekt mitgewirkt oder es auch nur wohlwollend begleitet haben! Besonders gilt der Dank natürlich dem Bauherren, der Architektin und meinen Mitstreitern R. und E. Tischendorf. Aber auch und ganz besonders meiner lieben Frau, die mir wieder einmal den Rücken freigehalten hat und eine unentbehrliche Hilfe war!
Es war uns eine große Ehre, wieder einmal auf den Spuren Hermann Glöckners zu wandeln und die kulturelle Vielfalt Radebeuls um ein weiteres Puzzleteil zu bereichern!
Robert Bialek