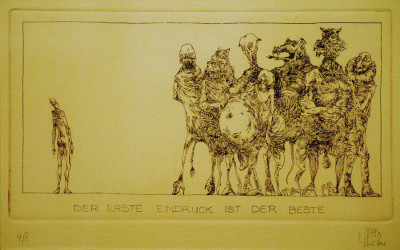Der Verein wird sich auch in diesem Jahr wieder in die städtebauliche Diskussion einbringen und versuchen, weiterhin Fürsprecher unserer Denkmale und des Stadtbildes, aber auch offen für Neues zu sein. Entsprechend ist unser Programm gestaltet, zu dem wir herzlich einladen. Als Moderator und Impulsgeber verstehen wir uns insbesondere beim zweiten Forum Was macht Radebeul aus; diesmal unter dem Thema „Wohin führt uns die Meißner Straße“. Diese ist ein Brennpunkt in der Verkehrsdiskussion und an sie sind viele Erwartungen gerichtet: sie soll den Verkehr bündeln und Ausweichverkehr vermeiden, überregionalen Verkehr durch die Stadt leiten und den Touristen als sächsische Weinstraße durch Radebeul führen. Da wir aber ein überkommenes Straßennetz haben und zum Glück keine großen Zerstörungen hinnehmen mussten, sind in vielen Bereichen die Ausbauquerschnitte erreicht. Gleichzeitig haben viele Familien mehr als einen PKW, wird der öffentliche Nahverkehr weiterhin stark nachgefragt und fahren wir wie auch unsere Kinder gern Rad. So bleibt als Alternative, neben einer guten Straßenqualität, oftmals nur, Rücksicht zu nehmen, rechtzeitig loszufahren, das „Immer mehr“ des täglichen Wollens nicht im Straßenverkehr für sich herauszufahren. Aus diesen Gedanken heraus erscheint es wichtig, dass wir unser Leitbild, unsere Vision der Meißner Straße fortentwickeln: für wen soll und kann sie da sein (z. B. Schwerlastverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, PKW-Verkehr, Radverkehr, Handel, Wirtschaft, Wohnbebauung, Weinstraße, Aus- und Eingangstor zu Dresden und Coswig). Es sollte uns dabei nicht stören, dass ein Ziel vielleicht niemals ganz erreichbar ist, das Leben stets Abweichungen bereithält und manches nur für Teile zutrifft. Aber einen Leitgedanken zu haben, versetzt uns in die Lage, Vorhaben hieran zu messen und bewusst steuern zu können. Deshalb lädt der Verein für Freitag, den 16. Mai, herzlich in das Gymnasium Luisenstift um 19.30 Uhr ein. Sie sind gern gebeten, bereits vorab uns ihre Kurzstellungnahmen zuzusenden (vv@denkmalneuanradebeul.de), weil wir dann gezielt die Veranstaltung mit Themengruppen vorbereiten können, es soll ja nicht nur dabei bleiben, dass sich jeder seines Unmutes über die Zustände entledigen kann.
Ein weiteres zentrales Vereinsthema ist natürlich der Bismarckturm mit der Idee der Belebung des Denkmales, um damit dessen Sicherung erreichen zu können. Hier läuft unsere Sammlungsaktion gut, ca. 45.000 € sind schon zugesagt und damit etwa ein Viertel der benötigten Mittel, um eine Treppe und eine multimediale Installation einbringen zu können. Letztere ist uns genauso wichtig wie die Treppe, denn sie soll die Geschichte der Stadt dem heutigen Blickfeld gegenüber stellen. Aus einem Schauen ins Land kann damit ein bewusstes Schauen in die Stadtentwicklung werden. Werden Sie Pate einer Stufe oder eines Podestes; Stufen kann man auch gemeinsam mit anderen „erwerben“ und die Namen auf dieser eintragen lassen.
Weitere Themen, mit denen sich der Verein in 2014 befassen möchte, sind am 11. April ein Vortrag mit anschließender Gesprächsrunde zu „Bäumen in Radebeul“. Uns wird interessieren, was in den letzten 20 Jahren gewachsen und verschwunden ist, also die Ergebnisse der Baumerfassung, und in welchem Zustand sich der Baumbestand Radebeuls befindet. Es geht um einen wichtigen Teil des Stadtgrüns und nicht zuletzt steht die Frage zur Beantwortung an, wann ein Baum gefällt werden muss. Am 14. September soll es dann um „Die Haustür – Der Ausweis des Hauses“ gehen. Der Verein bemüht sich ja, auch mit ganz praktischen Hinweisen zu helfen und Orientierung zu geben. Mit Vortrag und Diskussion unter dem Titel „Weißt Du, wo Du wohnst? Radebeuler Ortsteile, ihre Grenzen und geographische Hintergründe“ schließen wir die diesjährige Vortragsreihe ab.
Besonders liegt uns natürlich auch das Erleben der Stadt in ihren Ortsteilen am Herzen. Daher wechseln sich jährlich der Tag der offenen Aussicht und der Tag des offenen Gartens ab. Am 14. Juni, zum dritten Mal nunmehr, ist es wieder soweit: alle interessierten Radebeuler sind herzlich eingeladen, grüne Kleinode zu erleben und sich so Anregungen zu holen und auszutauschen. Wer wann wo für uns öffnet, erfahren Sie rechtzeitig aus der Presse. Interessierte Gartenbesitzer, die jetzt oder in den nachfolgenden Jahren ihren Garten für Besucher öffnen möchten, können sich gern unter der o.g. Email an uns wenden. Das gilt natürlich auch für alle Themen, die der Verein in Radebeul vertreten kann.
Nicht zuletzt lädt jeden letzten Samstag im Monat 11 Uhr der Verein zu einer literarischen Führung durch den Hohenhauspark ein. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der 100ste Todestag von Marie Hauptmann am 6. Oktober.
Dr. Jens Baumann