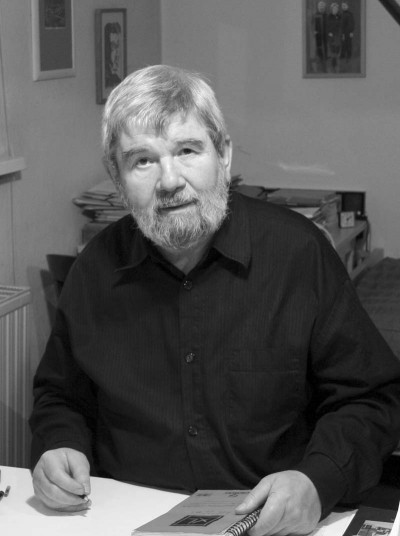Zur »My Fair Lady«-Premiere an den Landesbühnen
Am Ende – als Ergebnis der turbulenten Ereignisse in London am Beginn des 20. Jahrhunderts – haben sich nicht nur Eliza und ihr Vater Alfred P. Doolittle, sondern auch der Phonetik-Professor Henry Higgins in ihrem jeweiligen Wesen gründlich gewandelt. Glaubt man zumindest auf den ersten Blick. Wenn es denn wirklich so wäre, dann hätte der Dichter und Dramatiker George Bernhard Shaw allerdings seinem Ruf, schärfster Kritiker eben jener Gesellschaft gewesen zu sein, nicht gerecht werden können. Denn das Vorbild für jenen experimentierfreudigen Professor im Musical »My Fair Lady« ist die Figur des Königs »Pygmalion« aus der griechischen Sagenwelt, der aus vielerlei Gründen Frauen nun mal nicht mag, sich aber dann doch in ein Mädchen verliebt, das allerdings nur als elfenbeinerne Statuette existiert. Der Pygmalion des Musicals nun ist jener Professor Henry Higgins. Und der bleibt im Grunde der überhebliche und menschenverachtende Wissenschaftler, der er vor seinem Experiment mit dem Blumenmädchen Eliza schon war. Auch wenn er – als ihm ihre Abwesenheit bewusst wird – fast flehend singt »Ich bin gewöhnt an ihr Gesicht«. Sogar an Elizas versoffenem Vater hat Higgins gefehlt; denn der ist mit seinem gesellschaftlichen Aufstieg zum brillanten Rhetoriker alles andere als glücklich geworden. Higgins selbst vermisst Eliza zwar, doch weniger als die junge liebenswerte Frau, sondern mehr als willfährigen und geduldigen Blitzableiter für seine maskulinen Wutausbrüche. Er nennt sie nun zwar nicht mehr »Drecksstück« und »Rinnsteinpflanze« wie am Anfang seines Unterrichts, dennoch ist sie nach seinem überheblichen Selbstverständnis immer noch ein »unverschämtes Insekt«.
Alles in allem ein grandioser Stoff, der seinerzeit geradezu nach einer Vertonung schrie. Zuvor aber kam ein erster Film, 1938 von Gabriel Pascal produziert. Danach erst folgte das Musical, dessen Skript Alan Jay Lerner verfasste und dessen mitreißende Musik Frederick Loewe komponierte. 1956 dann wurde der Film zum Musical »My Fair Lady« fertig mit einer wunderbaren Audrey Hepburn in der Rolle der Eliza Doolittle und einem ebenso trefflichen Rex Harrison als Henry Higgins.
An den Landesbühnen Sachsen in Radebeul erlebte die »Lady« nun am 16./17. Januar 2010 in einer Inszenierung von Horst O. Kupich eine Neuauflage. Antje Kahn konnte dabei in der Titelpartie stimmlich und spielerisch genauso überzeugen wie Michael König in der Rolle des Professor Higgins. Eine ebenfalls ideale Besetzung wurde mit Dietmar Fiedler gefunden, der den trinkfesten und schlitzohrig argumentierenden Alfred P. Doolittle sang und spielte. Falk Hoffmanns Part des in Eliza verliebten jungen Freddy Eynsford-Hill dagegen bleibt blass, was man aber nicht dem Sänger, sondern der Rolle anlasten muss. Und die Figur von Higgins Wettkumpel Oberst Pickering (Jussi Järvenpää) degradierte die Regie leider zu einer Karikatur. Völlig unmotiviert musste er ständig die Hacken zusammenschlagen, Haltung annehmen und salutieren. Dabei ist doch an Dienstgrad und Uniform für jeden ablesbar, dass Pickering vom Militär kommt.
Das Bühnenbild (Stefan Wiel) erweist sich als ausgesprochen variabel. Die jeweilige Szenerie (beispielsweise der Blumenmarkt am Covent Garden) formiert sich hinter einem durchsichtigen Zwischenvorhang. Die Auftritte erfolgen aus einer Art überdimensioniertem Grammophontrichter heraus; links und rechts wird die Bühne dabei von den wuchtigen Schriften Higgins’ (»Higgins Universal Alphabet«) und Pickerings (»Das gesprochenen Sanskrit«) gesäumt. Der recht intensive Einsatz des Balletts (Choreographie: Reiner Feistel) in den Massenszenen rundete das Bühnengeschehen auf erfrischende Weise ab, und das Orchester unter Stabführung von Hans-Peter Preu widmete sich mit Hingabe und Spiellaune all den berühmten Ohrwürmern.
W. Zimmermann
[V&R 2/2010, S. 9f.]