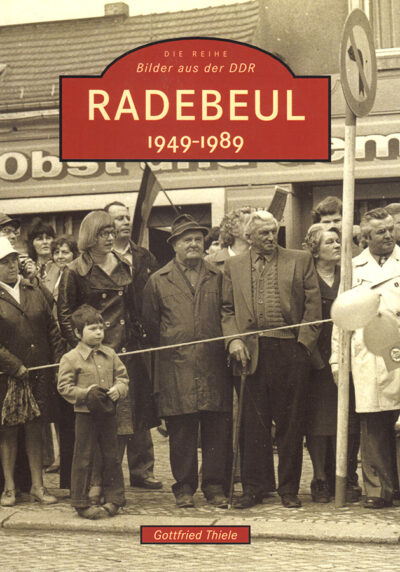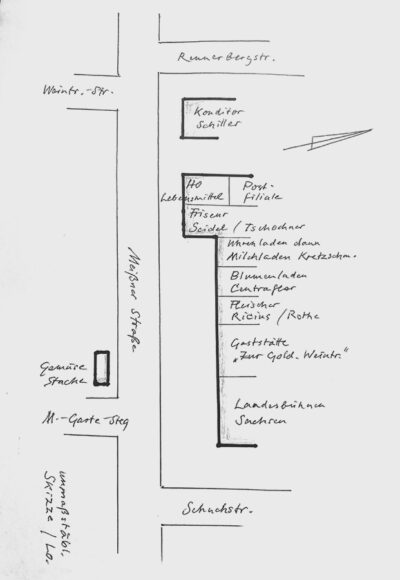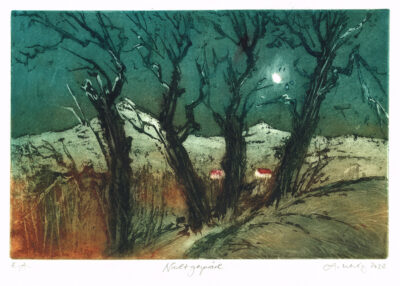Feste druff!
Nun ist Motzi eben Motzi! Der führt kein Florett, sondern wohl einen Säbel. Scharf muss er nicht sein. Aber als ehemaliger Bauarbeiter weiß er ihn wohl kräftig zu führen, ist er doch nicht gerade zart besaitet. Vielleicht sollte also die Redaktion von Vorschau & Rückblick künftig an die Glosse und sicher an noch einige andere Artikel eine Trigger-Warnung hängen: Vorsicht – gefährlicher Inhalt! Am besten gleich auf dem Umschlag des Heftes. Da ist rechts unterhalb des Titels noch eine Menge Platz. Man kann ja nie wissen, wer sich wiedermal wegen eines unbedachten Wortes, einer unglücklichen Kombination oder einer falschen Interpretation auf den Schlips oder auf sonst was immer getreten fühlt, in einen psychischen Notstand getrieben oder gar „lebensgefährlich“ verletzt fühlt. Sicher ist sicher! Es war ja nicht so gemeint!!!
Zugebeben, ich bin nicht in der Position, wo ich die große Klappe haben kann. Ich steh keiner Gemeinde vor, sitze in keinem Parlament und kann auch keine Waffen in alle Welt kutschieren. Hab eh nur einen Handwagen. Aber offensichtlich scheint für manche Leute das gesprochene und geschriebene Wort die gefährlichste Waffe aller mörderischen Kriegsgeräte zu sein. Man kennt das ja seit Jahrhunderten. Diese Mischung aus Verbot und Selbstzensur ist seit Ewigkeiten in Mode. War es nicht Cäsar, den man kollektiv hinterrücks meuchelte? Und die Antreiber von der anderen Seite, wie die Großklappe des Deutschen Reiches, will ich gar nicht erst ins Feld führen.
Nun hoffe ich doch noch davonzukommen. Aber ab welcher Verfehlung ist man eigentlich des Todes? Das wüsste ich schon gern – so für meine mögliche eigene Zukunft. Denn, wie schreibt man eine Glosse, ohne jemandem zu nahe zu treten?
Dieses Feld wird seit der Antike bestellt, wenn auch die Bestimmung sich gewandelt hat. Was einst als erklärende Randnotiz gehandhabt wurde, kommt heute polemisch, satirisch, pointiert daher und ist nicht immer leicht zu schlucken. Ein wenig „Spaß“ muss man wohl verstehen als Leser, auch wenn die meisten Glossen nicht nur motzen, sondern sich zwischen ihren Zeilen durchaus Bedenkenswertes verbirgt. Dem begabtesten Glossenschreiber der Weimarer Republik ist das nicht gut bekommen. Ich hoffe nur, dass wir diese Zeiten überwunden haben. Gab es da nicht neulich so eine ominöse Zusammenkunft?
Nun kann man sich für das über uns hereingebrochene Festjahr allerlei wünschen und einfallen lassen. Und es freut mich ungemein, wenn sich die Bürger der Stadt Radebeul ganz eigene Gedanken dazu machen. Und noch schöner, wenn diese dann noch im Festprogramm Aufnahme gefunden haben. Denn, so ein Glück hatten nicht alle.
Ein Königreich wie England sind wir leider noch nicht. Die verstehen es eben zu feiern! Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht in fünf Jahren? Nur die Sache mit der EU macht mir Sorgen. – Ist aber alles nicht so gemeint! Ein kleiner Scherz am Rande.
Die schönsten Feste sind allemal die, die nichts kosten. Und um auf die Blumenwiesen zurückzukommen, kosten einige Samentütchen vom Baumarkt oder einer ortsansässigen Gärtnerei nun wirklich nicht die Welt. Auf diese Weise könnte man, gewissermaßen an alte Traditionen anknüpfend, buchstäblich die ganze Stadt und nicht nur einige Vorgärten zum Erblühen bringen, wenn es schon an Festschmuck fehlt. Das wär dann wohl die beste Glosse aller Zeiten, meint
Euer Motzi.