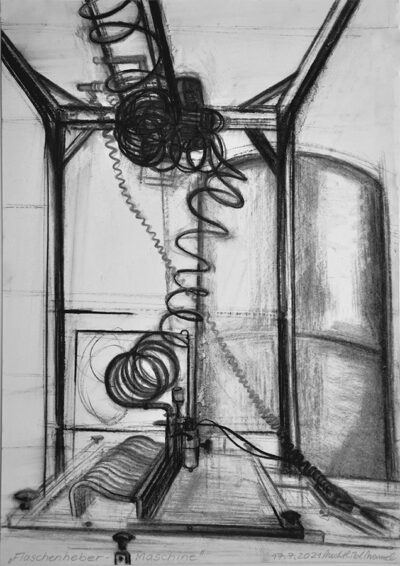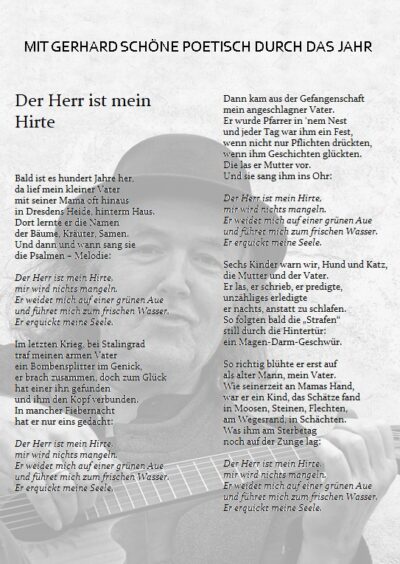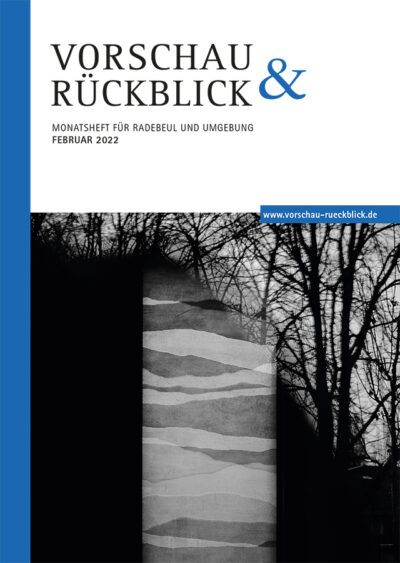Ullis Blumenladen jetzt in der Moritzburger
Es war ein trauriger Anblick, als Hans-Ulrich Belau und seine Mitarbeiterin letzten Heiligabend nach Ladenschluss an einem kleinen Tischchen mit einer Flasche Sekt saßen, umgeben von Utensilien, die nun einmal in einem derartigen Geschäft so anfallen. Nobel sah der Laden ohnehin nicht mehr aus, hatte doch der „Zahn der Zeit“ überdeutlich für jedermann seine Spuren hinterlassen. Den abgewirtschafteten Zustand der Räume wusste Ulli durch geschickte wie geschmackvolle Arrangements von Pflanzen, Möbeln und Accessoires wohl zu verdecken, wenngleich die vielen Behälter, die bei Regen das von der Decke tropfende Wasser auffingen, nicht zu übersehen waren. „Ein Ende mit Schrecken“, so dachten wir damals. „Wieder geht etwas Besonderes unwiederbringlich verloren!“ Wem ist es schon zu verdenken, wenn einer sein Grundstück gewinnbringend verkaufen kann, in welchem sich Belau nur zur Miete befand?
Eigentlich wollte Ulli hinschmeißen. Er schien mit seiner Kraft am Ende. Aber Radebeul ist ihm in den inzwischen elf Jahren doch sehr ans Herz gewachsen. Er fühlt sich hier wohl und angenommen. Da erfreute natürlich sicher nicht nur uns die Nachricht über einen eventuellen Neustart in der Moritzburger Straße. Eine zweite „Alte Gärtnerei“ würde es vermutlich nicht werden, aber immerhin sollte es weitergehen.
Anfang Februar war es dann soweit! In der Moritzburger Straße Nr. 11 eröffnete pünktlich am „2.2.22“ Ullis Blumenladen! Wochen zuvor hatten beide mit Unterstützung von Freunden entsorgt, transportiert, geräumt, gemalert, gepinselt, gehämmert, geschraubt, verlegt und besonders arrangiert. Herausgekommen ist ein kleines Schmuckstück, welches in Radebeul seinesgleichen sucht. Glücklich standen beide im übervollen Laden und konnten sich vor lauter Arbeit kaum um ihre Gäste kümmern, die „nur“ zum gratulieren gekommen waren. Alle hatten eine Kleinigkeit mitgebracht, sogar eine „Blumentorte“ mit der Aufschrift „Viel Erfolg! Ullis Blumen-Laden“.
Wir fanden uns erst gegen Nachmittag ein und blieben verwundert an der Tür stehen. Was wir sahen hatte uns völlig überrascht. Den morbiden Charme der „Alten Gärtnerei“ noch im Hinterkopf, fanden wir uns nun in einem Etablissement der nobelsten Art wieder. Auf antiken Möbeln, abgearbeiteten Tischplatten, auf Gartenstühlen und Obststiegen waren kunstvoll getriebene Metallgefäße, Vasen, Glasschalen, kleine Porzellanfiguren und sonstiger Nippes arrangiert, zwischen denen blühende Blumenstöcke, Sträuße und Zweige platziert waren. Eine Bilderwand in
„Petersburger Hängung“ über einer Anrichte ergänzte die geschmackvolle Einrichtung. Dominiert wurde der vordere Raum allerdings von einem fast wandhohen, expressiven, Ölgemälde, welches wie ein Kontrapunkt zum Übrigen wirkte. Wir waren überwältigt, blieben staunend stehen und konnten uns nicht sattsehen. So wie uns ging es auch Anderen. Obwohl geöffnete Sektflaschen bereitstanden, fand sich wegen der vielen Kunden keine Gelegenheit, um mit Ulli und seiner Mitarbeiterin anzustoßen. So haben wir ohne die Beiden auf ihr Wohl und ein gutes Gelingen am neuen Standort getrunken und versprochen wiederzukommen. Was uns bemerkenswert schien, ist, wie Hans-Ulrich Belau und seine Mitarbeiterin eine Niederlage durch kreative Energie in einen positiven Gewinn für sich und andere umzumünzen verstanden.
Unsere Hochachtung!
Karin und Karl Uwe Baum