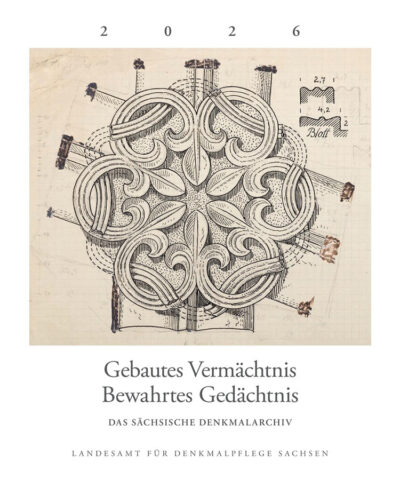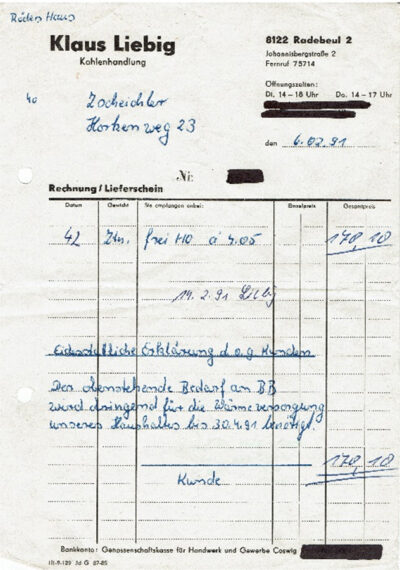Sonntag, 1. März, 16 Uhr, Weingewölbe, Hoflößnitzstr. 82
Zum Auftakt geht´s an einen ungewöhnlichen Ort: einen ehemaligen Bunker im Weinberg. „RADEBEUL Ein Lese Buch“ aus dem Notschriftenverlag verrät, was es damit auf sich hat. Thomas Gerlach und Jürgen Stegmann lesen Geschichten und Gedichte aus und über Radebeul. Den passenden Wein dazu sowie einen kleinen Imbiss hält Winzer Thomas Teubert parat.
Montag, 2. März, 17.30 Uhr, Stadtbibliothek Ost, Sidonienstr. 1c
Der Kulturverein der Stadtbibliothek lädt zum Gespräch über Literatur. „Nikolai Karasim: Briefe eines russischen Reisenden“. Ein junger russischer Adliger unternimmt Ende des 19. Jhd. eine Reise durch Westeuropa und kommt in Paris mit der französischen Revolution in Berührung.
Dienstag, 3. März,19 Uhr, Gartenzimmer im Lutherhaus der Friedenskirche, Altkö 40
„Frauen & Männer – Männer & Frauen“ . Der Dresdner Autor und Pfarrer i.R. Hans-Jörg Dost erzählt vom tatsächlichen Leben. Musikalisch wird er von Norbert Arendt am Flügel begleitet. In jeder Geschichte sind Frauen und Männer, Männer und Frauen für einander von unübersehbarer Bedeutung – in ihrer Verfehlung wie auch zu ihrem Glück.
Donnerstag, 5. März, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek Ost, Sidonienstr. 1c
Lesung mit musikalischer Begleitung: Jürgen Stegmann liest aus „Landesbühne“ von Siegfried Lenz. Während einer Theatervorstellung in der JVA verlassen Häftlinge mit dem Bus der Landesbühne das Gelände. Bei einem Volksfest werden sie für die lang erwarteten Schauspieler gehalten. Jetzt müssen sie all ihr Talent einsetzen, damit der Schwindel nicht auffliegt.
? Voranmeldung notwendig: Stadtbibliothek Radebeul-Ost, Tel. 0351 8305232 oder bibliothek@radebeul.de
Freitag, 6. März, 18.30 Uhr, Flack`s Getränkehandel, Hoflößnitzstr. 3
Cara Catalina Fox & Tabea Weingardtner erzählen Begebenheiten rund um die Fortbewegung auf zwei Rädern… ob auf dem Drahtesel oder der Harley Davidson: mit Charme, Witz, Dramatik und Tiefgang. Lebendig, authentisch, ungeschminkt und kurzweilig.
Samstag, 7. März, 14 Uhr bis „open end“, Lößnitzbar – Lokal & Bühne, Fabrikstraße 47 (am Lößnitzbad)
Die „Lößnitzbar“ beendet ihre Winterpause – mit zwei Lesungen am gemütlichen Kamin und Weltmusik am abendlichen Lagerfeuer.
14 Uhr: „Böhmische 21“ heißt der Erzählband von Edward Güldner, aus dem Schauspieler Michael Heuser liest, musikalisch begleitet von Peter „Salbei“ Schlott. Geschichten aus der Dresdner Neustadt – Geschichten aus der wilden und anarchischen Wendezeit.
17 Uhr: Monika Groth erzählt eine Geschichte über Freiheit, Musik und Erwachsenwerden. „Mixtape of an Eastern Girl“ ist ein autofiktionaler Roman über das Aufwachsen in der DDR, weibliche Selbstermächtigung und Musik als existenzielle Überlebenshilfe. Joni Müller wächst auf zwischen Plattenbau und leiser Rebellion, Sehnsucht und Widerspruch. Musik wird ihr Fluchtpunkt.
19 Uhr: Krambambuli spielt Weltenmusikgroovejazz aus Swing-Manouche, Musette, Osteuropa, Tango & mehr… Besetzung: Akkordeon, Kontrabass, Gitarre, Geige, Klarinette, Drums