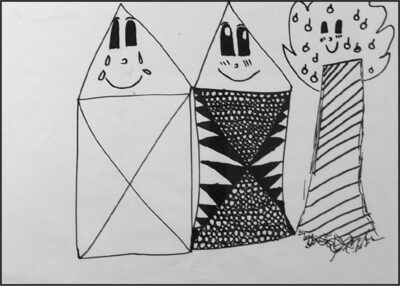Bücherkisten und allerhand Lesungen an ungewöhnlichen Orten
Die Radebeuler Gewerbetreibenden, Händler und Gastronomen gestalten den April zum bunten Frühlingsevent: Überall in Radebeul-Ost und in Radebeul-West / Kötzschenbroda laden Bücherkisten und Lesebänke zum Verweilen und Stöbern ein. Gern können Bücher auch ausgeliehen und mit nach Hause genommen werden.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe kleiner, feiner Lesungen sowohl für große als auch kleine Leute. Das Besondere daran: Die Lesungen finden an ungewöhnlichen Orten statt, quasi gleich um die Ecke. Fast an jedem Tag im April lädt ein anders Geschäft, eine Galerie, ein Studio oder eine Gaststätte zu sich ein. Hiesige Buchautoren, Schauspieler oder gar die Ladeninhaber selbst nehmen die Zuhörer mit auf kleine Lesereisen. Zu hören sind Radebeuler und Kötzschenbrodaer Geschichte(n), was gut in unser Jubiläumsjahr passt.
Den Auftakt macht am 3. April die Galerie Gisbert, wo aus einem Buch von Tine Schulze-Gerlach gelesen wird, welches – wie sollte es anders sein – in Radebeul spielt. Kinder können sich unter anderem auf „Felix, die kleine Wildsau“ und „Das wunderbare Wollparadies“ freuen. Das Publikum trifft mehrmals auf Karl May, erfährt Sinniges und Unsinniges zum Thema Gesundheit und erlebt, wie es am „Haltepunkt Kötzschenbroda“ zugeht… Am 28. April beschließt die Stadtgalerie die umfangreiche Lese-Runde mit Texten von Thomas Gerlach.
Das vollständige Programm:
– 3. April, 19 Uhr, Galerie Gisbert, Bahnhofstr. 19c
Jens Kuhbandner liest aus „Erinnerung an Maurice“ von Tine Schulze Gerlach
Eine Wohngegend in Radebeul, Ende der 1960er Jahre. Verschiedenste Leute sind dort zu Hause: Ärzte und Schwestern, Betonbauer und Chemielaborantinnen, Lehrausbilder, Schriftsteller und Maler… Ein Spiegel nicht nur jener Zeit.
– 5.April, 18 Uhr, Münch´s Backstube, Meißner Str. 250
Jürgen Stegmann liest „Geschichten aus dem Weinberg“ von Reiner Roßberg, Winzermeister aus Radebeul
– 9. April, 17 Uhr, Brillenoutlett, Hauptstr. 12
Jürgen Stegmann liest „Wie brate ich eine Maus oder die Lebenskerben des kleinen Roaul Habenichts“
– 10. April, 16.30 Uhr, Lesung für Kinder, Kinderhaus, Altkötzschenbroda 53a Annette Richter liest aus ihrem Buch „Felix, die kleine Wildsau“ Felix ist ein richtiges Wildschwein und lebt nicht im Wald oder im Wildgehege, sondern bei Familie Mückenbein, in einem Dorf, im Haus am Ende einer Huckelstraße. Ein Leben voller Abenteuer, bis etwas passiert…
– 12. April, 15 Uhr, Vika Lädchen, Meißner Str. 81
Lustige Kindergeschichten gelesen von Gabriele Namiß
– 12. April, 19 Uhr, Familienzentrum, Altkötzschenbroda 20
Radebeuler StadtGeschichte(n) Die Redaktion des kulturellen Monatsheftes „Vorschau & Rückblick“ präsentiert eine Auswahl „bemerkenswürdiger“ Texte aus fünf Jahrzehnten
– 16. April, 18 Uhr, Thalia, Hauptstr. 17
Eine junge Dresdner Autorin/Poetry Slammerin liest aus ihren Büchern
– 17. April, 17 Uhr, Formel Gesundheit, Sidonienstr. 4a
So kommt man in die Jahre… Älterwerden mit Wilhelm Busch
– 17. April, 19 Uhr, Notschriften-Verlagsladen, Bahnhofstr. 19a
Jens Kuhbandner liest aus seiner Erzählung „Tandaradei“ Meißen 1211: Der Minnesänger Walther von der Vogelweide ist Dienstmann beim Markgrafen. Auf einem Botengang lernt er die Schäferin Anna, eine junge Witwe aus Kötzschenbroda, kennen. Inspiration für eines seiner berühmtesten Lieder…
– 19. April, 19 Uhr, Sonnenhof, Altkötzschenbroda 26
Mandy Hähnel liest als Klara May aus den Werken von Karl May und verrät dabei so manches Geheimnis. Sie lässt ihn als Helden, Ehemann und vielleicht ein wenig göttlich erscheinen. Mit Witz und Charme erzählt sie von ihren Reisen und erwähnt so manche Episode mit einem Augenzwinkern zwischen Wahrheit und Phantasie.
– 19. April, 19 Uhr, Miss Sporty, Meißner Str. 79
Schon aufgeklärt? Bewusster Leben, bewusster essen
Sinniges und Unsinniges rund um das Thema Gesundheit
– 20. April, 10 Uhr, Osteopathie K. Eulitz, Gartenstr. 13
Finde ein bisschen Glück für jeden Tag
Anregendes zum Nachmachen
– 22. April, 19 Uhr, Reformhaus Schreckenbach, Hauptstr. 13
„Mama, wo warst du?“ gelesen von der Autorin Gitte Herzog
18 Jahre im Kinderheim – ganz anders als erwartet erzählt Gitte Herzog, wie positiv sie aus dieser Zeit hervorging.
– 24. April, 17 Uhr, Fotoatelier Meissner, Meißner Str. 108
Laubengeschichten von Thomas Gerlach gelesen von Jürgen Stegmann Die kleinen Häuschen prägen das Stadtbild von Radebeul und sind hier und da in unterschiedlichem Zustand anzutreffen. Sie erzählen auf ihre Art interessante Geschichten aus der Lößnitz.
– 24. April, 18 Uhr, SZ-Treffpunkt, Bahnhofstr. 18
Anja Hellfritzsch liest aus ihrem Roman „Haltepunkt Kötzschenbroda“ Die Ruhe in Kötzschenbroda, Ende des 19. Jahrhunderts, täuscht. Eine verschlafene Dorfgemeinschaft im Spannungsfeld der Moderne: Es gibt Aufstieg und Niedergang. Über allem schwebt die verhängnisvolle Liebesgeschichte des Gemeindevorstandes.
– 25.April, 19 Uhr, Restaurant Brummtopf, Eduard-Bilz-Str. 6
„Nach einem Schlag ist nichts mehr wie es war“ von und mit Heike Herzog Ein Schlaganfall hat der Autorin einen langen Kampf gegen körperliche Leiden und abgrundtiefe Ängste abverlangt. Wie sie ihn gewinnt, erzählt sie in ihrem Buch.
– 26.April, 18 Uhr, Wolldepot, Hauptstr. 23
„Das wunderbare Wollparadies“ von Manuela Inusa Susann verbringt ihre Zeit am liebsten in ihrem kleinen Wolle-Laden, und mit ihren Freunden erlebt sie so manches Abenteuer. Für große und kleine Woll-Depot-Fans.
– 26.April, 19 Uhr, Restaurant Brummtopf, Eduard-Bilz-Str. 6
Old Shatterhand und der Fluch des Erfolges, Live-Hörspiel mit dem Theater Heiterer Blick nach Karl Mays „Freuden und Leiden eines Vielgelesenen“ Karl May beschreibt einen angeblich ganz normalen Wochentag in der „Villa Shatterhand“. Wie in seinen Erzählungen vermengen sich dabei Dichtung und Wahrheit. Ein Tag des Jahres 1896 als heiteres Hörspiel.
– 28. April, 15 Uhr, Stadtgalerie, Altkötzschenbroda 21
Jürgen Stegmann liest Texte des Radebeuler Schriftstellers Thomas Gerlach, Kunstpreisträger der Stadt Radebeul. – Gute Gelegenheit, sich die Ausstellung „Voll das Leben“, Fotografien von Harald Hauswald, in der Stadtgalerie anzuschauen.
Eine vorherige Anmeldung sichert die besten Plätze
lesen@radebeul-gemeinsam.de
Spontane Gäste sind ebenfalls immer willkommen.