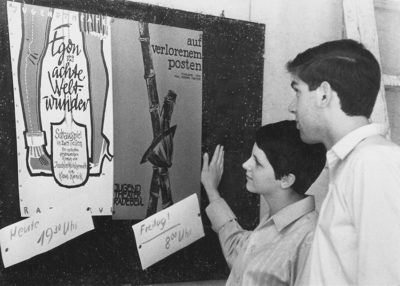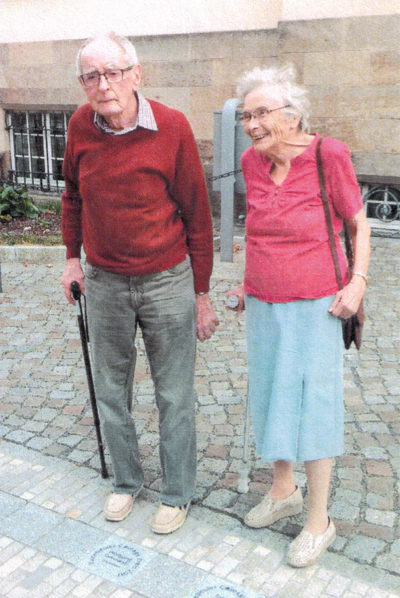Vom Leben vor und hinter hohen Mauern
„Wer schreibt, der bleibt.“ Wieder so ein Spruch, bei dem keiner so richtig weiß, wie das gemeint sein könnte. Zumindest macht sich nicht jeder Schreiber (m/w/d) beliebt. Aber wer schreibt schon, um sich beliebt zu machen?

»LABratorium« / Lügenmuseum – Alphörner zum Auftakt der intermedialen Performance- und Mitmachaktionen auf den Elbwiesen in Altkötzschenbroda, August 2020
Foto: Karin (Gerhardt) Baum
Als gebürtige Radebeulerin gehöre ich einer beständig schrumpfenden Minderheit an, seitdem es in der Großen Kreisstadt keine Geburtenklinik mehr gibt. Ist das etwa die späte Rache der Dresdner, weil ihre Eingemeindungsabsichten bis jetzt gescheitert sind? Ganz schön schlau eingefädelt, könnte man meinen.
Wenn ich ehrlich bin, stimmt das ja auch nicht so ganz mit der Formulierung „gebürtige Radebeulerin“. Eigentlich müsste ich einen Dreifachpass besitzen mit dem Eintrag „geboren in sowohl als auch: Radebeul-Kötzschenbroda-Niederlößnitz“. Vielleicht erklären sich aus diesem verworrenen Umstand meine beständigen Versuche, herausfinden zu wollen, wie die Lößnitzstadt tickt und wohin sich dieses Konglomerat entwickelt?
Glücklicherweise hatte ich das Privileg über viele Jahre im Radebeuler Kulturamt einer Tätigkeit nachzugehen, die voll und ganz meinen Neigungen und Interessen entsprach. Aus heutiger Sicht wohl eher eine Ausnahme. Damit der Eintritt in den sogenannten „Ruhestand“ ein wenig rebellische Würze bekommt, erteilte mir vor zwei Jahren mein geschätzter Redaktionskollege Dr. Bertram Kazmirowski (seit 1995 Mitglied der Jugendredaktion des Monatsheftes „Vorschau und Rückblick“) den Auftrag, „knapp 30 Jahre nach der politischen Wende immer wieder daran zu erinnern, welch hohes Gut Meinungs- und Pressefreiheit sind und wie unsere Demokratie auch davon lebt, dass unbequeme Wahrheiten ausgesprochen werden.“ (VUR, 03/2019) Derart legitimiert und der Wahrheit verpflichtet, möchte ich in dieser Beitragsserie einige Themen aufgreifen, welche in Radebeul vermutlich nicht nur mich beschäftigen. Es geht um städtische und private Räume, es geht um den Einzelnen und die Gemeinschaft, es geht um Gestalten und Verwalten, es geht um Gelungenes und Gescheitertes …

„Gute-Laune-Stelzen-Zwerge“ – zur Kasperiade in Radebeul-Ost, Juni 2020
Foto: Karin (Gerhardt) Baum
Das alles hat eine Vorgeschichte. Diese fängt mit dem Trauma an, dass ich zwar eine gebürtige Radebeulerin bin, aber keine Alteingesessene mit bodenständiger Ahnengalerie. Meine Mutter und Großmutter gehörten zu den „Ausgebombten“, die im Februar 1945 durchs brennende Dresden bis nach Radebeul gelaufen sind. Mitnehmen konnten sie außer ein paar Dokumenten und Fotografien praktisch nichts. In Radebeul fanden sie fürsorgliche Aufnahme und später ihr Zuhause. Mein Vater wiederum fand in Radebeul meine Mutter und blieb. Aus dem klimatisch raueren Vorerzgebirge stammend, erfreute er sich immer wieder aufs Neue an der üppigen Vegetation zwischen Elbe und Hang. Besonders der Frühling, wenn der Flieder, die Magnolien, Forsythien, Kirsch- und Aprikosenbäume blühten, hatte es meinem Vater, dem Zugezogenen, angetan. Seine „Besitzergreifung“ der neuen Wahl-Heimat erfolgte auf eine sehr ideelle Art. Schließlich muss man nicht alles besitzen, um sich daran erfreuen zu können.
Mit dem gesellschaftlichen Umbruch ging jedoch auch so manche Utopie in die Brüche. Als sich das DDR-Volk für den Unterschied zwischen „Privateigentum“ und „Volkseigentum“ zu interessieren begann, war es bereits zu spät. Viele Menschen, die bis zu diesem Zeitpunkt ein völlig anderes Verständnis von Eigentum hatten, waren diesem Prozess wehr- und hilflos ausgeliefert. Ein Großteil der Ländereien und Immobilien wechselte zu neuen Besitzern aus den „alten“ Bundesländern. Statt Glasperlen gab es diesmal Bananen. Ironisch könnte man meinen: „Selber schuld, Augen auf bei der Partnerwahl“. Nein, die DDR will ich ganz bestimmt nicht wieder haben. Und doch bin ich sehr froh, in diesem untergegangenen Land gelebt zu haben, in diesem Land, wo es nur selten Bananen gab.

„Mitsommernachtsträume“ – Fassadenillumination von Claudia Reh in Altkötzschenbroda, Juli 2020
Foto: Karin (Gerhardt) Baum
Der gesellschaftliche Umbruch war eine Zäsur und wirkt bis heute nach. Was mit der DDR in Beziehung stand, wurde immer mehr zum Observations- oder Sammelobjekt. Und mit dem zeitlichen Abstand wuchs das Interesse am Vergleich zweier sehr verschiedener Gesellschaftssysteme. Das Reflektieren, gespeist durch das eigene unmittelbare Erleben, empfinde ich als eine biografische Bereicherung. Dass sich neuerdings immer mehr junge Menschen für die ehemalige DDR zu interessieren beginnen und fragen, was denn da so anders war, finde ich schon deshalb spannend, weil sich durch deren Unvoreingenommenheit auch für mich Vieles zu relativieren beginnt. Was den Dauerstreit über Rechts- oder Unrechtsstaaten anbelangt, verlor dieser plötzlich an Präsenz. Denn wieder war es ein existenzielles Ereignis, welches das bis dahin Dagewesene übertraf und in ein Leben davor und ein Leben danach unterteilen sollte. Die Corona-Pandemie stellte das Funktionieren der Systeme in allen Ländern auf eine harte Probe und hielt ihnen den Spiegel vor. Globalisierung hatte man sich anders vorgestellt. Mit ausgleichender Gerechtigkeit hat die Pandemie ohnehin nichts zu tun, denn wie so oft, gibt es nur wenige Gewinner aber sehr viele Verlierer. Angesichts der Toten und Schwerstkranken mutet es ohnehin mehr als zynisch an, in einem solchen Zusammenhang von „Gewinnern“ zu sprechen.
Geradezu prädestiniert zum Unwort des Jahres 2020 wäre wohl auch der Begriff „Systemrelevanz“ gewesen. Doch bei wem liegt eigentlich die Deutungshoheit, wenn es darum geht den einzelnen Bereichen einen „systemrelevanten“ Platz auf der Wichtigkeitsskala zuzuweisen? Werden nur die Lauten gehört und die Leisen gehen unter? Museen, Galerien, Kinos, Theater und Konzerthäuser wurden geschlossen und schienen zunächst als steuerverschlingendes Beiwerk am ehesten entbehrlich zu sein. Aber selbst die „Erbsenzähler“ haben inzwischen erkannt, dass es nicht nur ums nackte Überleben geht.

„Atelier auf Abruf“ – Arbeitsbereich von Manuel Frolik in der Alten Molkerei, Juli 2020
Foto: Karin (Gerhardt) Baum
In Radebeul, der einzigen Stadt im Landkreis, die noch über ein Kulturamt verfügt, hatte man frühzeitig Nägel mit Köpfen gemacht. Kreiert wurde unter dem Slogan „Radebeuler LebensArt“ eine zeitlich und räumlich „entzerrte“ Veranstaltungsreihe, die eine Art zusammenfassenden Überbegriff für weitere kulturelle Angebote bilden soll. Die neuen Projekte erhielten griffige Bezeichnungen wie „Kunst geht in Gärten“, „Traumfabrik“, „KulTour“, „Mitsommernachtsträume“, „Weinboulevard“, „Weinherbst“, „LABratorium“ oder „Lichterpfad. Es wurde spontan improvisiert und in den unterschiedlichsten Konstellationen zusammengearbeitet. Künstler zogen von Ort zu Ort und das Publikum folgte ihnen. Selbst die Kasperiade und der Grafikmarkt wurden 2020 coronagerecht modifiziert und haben auf alternative Weise stattgefunden.
Was die Veranstalter allerdings mit dem Begriff „Radebeuler LebensArt“ meinen, hat sich mir als Radebeulerin noch immer nicht vollständig erschlossen. Haben sie nur ihre kleinen und größeren kulturellen Höhepunkte im Blick oder sind auch wir als Bewohner dieser Stadt gemeint, mit unserer nicht ganz so spektakulären „Radebeuler LebensArt“, die den Alltag vor und hinter den Radebeuler Mauern prägt? Der Erfolg dieser kulturellen Großoffensive war für die Veranstalter jedenfalls Dank und Bestätigung zugleich. Das Engagement aller Beteiligten sowie die unbürokratische Umwidmung bzw. Aufstockung von Fördergeldern haben diesen ganzjährigen Veranstaltungsmarathon möglich gemacht. Eine Fortsetzung in ähnlicher Form ist geplant.
Und doch bleiben einige Fragen offen. Hat sich mit der Organisation von Veranstaltungen bereits die Verantwortung der Stadtgesellschaft für ihre Künstler und Kulturschaffenden erschöpft? Will denn überhaupt jemand ernsthaft wissen, wie es den zumeist freischaffenden Einzelakteuren, die ohnehin noch nie auf Rosen gebettet waren, im Wechselbad der mehr oder weniger strengen Lockdowns ergeht? Dass über fünfzig Bildende Künstler sowie zahlreiche Musiker, Schriftsteller, Tänzer, Schauspieler u. v. m. in Radebeul ansässig sind, ist kein Geheimnis. Unter welchen Bedingungen sie leben und arbeiten, wurde in ihrer Komplexität allerdings noch nie untersucht. Natürlich ist die Kunst- und Kulturszene sehr flexibel, vielseitig und innovativ. Dieses aus finanzieller Sicht recht selbstgenügsame Metier erneuert sich immer wieder von innen heraus, vorausgesetzt es gibt verfüg- und bezahlbare Wohn-, Arbeits-, Proben-, Präsentations- und Veranstaltungsräume. Dass unter städtischer Regie der Radebeuler Grafikmarkt auch in diesem Jahr stattgefunden hat, war wichtig, aber eben nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Eine nachhaltige und langfristige Strategie zur Unterstützung der Kunst- und Kulturschaffenden vor Ort, ist das Gebot der Stunde. Der 2019 gegründete empathische Radebeuler Kulturverein wird die anstehenden Probleme allein nicht lösen können.

„genius loci“ – nur noch eine Erinnerung, Atelier von Gunter Herrmann (1938-2019) im Grundhof, Oktober 2020
Foto: Karin (Gerhardt) Baum
Hier schließt sich der Kreis. Wie eingangs erwähnt, war die Zerstörung Dresdens und der Totalverlust von nahezu allem, was man einmal besessen hatte, in meiner Familie immer präsent. Was noch funktionierte, wurde nicht weggeschmissen. Vielleicht resultiert aus dieser lebenslang praktizierten Haltung mein Drang, all das zu bewahren, was andere einmal unter Mühen geschaffen haben. Der willkürliche Gebrauch des Wortes „Schandfleck“, als vorgeschobenes Scheinargument, um sanierungsfähige Gebäude abreißen zu können, verursacht bei mir ein großes Unbehagen. Dieses Verhalten ist in meinen Augen destruktiv und unsozial. Zumal es andererseits einen dringenden Bedarf an bezahlbaren Kreativräumen gibt. Die Stadtgesellschaft und die jeweils zuständigen Verantwortungsträger sollten sich der öffentlichen Diskussion nicht länger entziehen. Wenngleich es so scheint, als hätten wir gegenwärtig ganz andere Probleme, hoffe ich mit diesem und den noch folgenden Beiträgen darauf aufmerksam zu machen, dass alles mit allem im Zusammenhang steht. Wenn Kunst und Kultur auch künftig ein ernstzunehmender Bestandteil der „Radebeuler LebensArt“ bleiben sollen, bedarf es eines verlässlichen und stabilen Fundaments. (Fortsetzung folgt)
Karin (Gerhardt) Baum