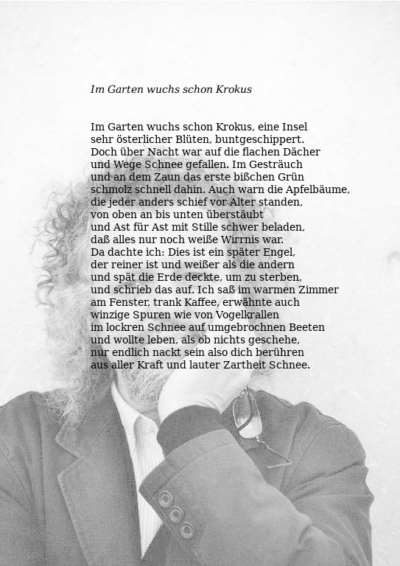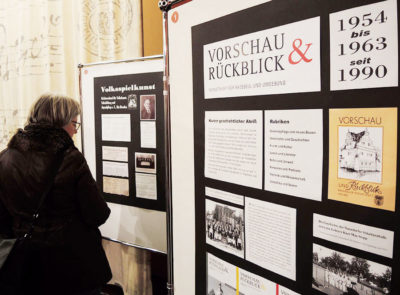oder das innerstädtische Zentrum Radebeul-West und die Bahnhofstraße
Jüngst war ich im Netto-Markt und wollte eigentlich nur einkaufen. Doch dann kam es unvermittelt zu einer Diskussion über die Situation in Radebeul-West. Drei Personen, drei Meinungen. Jeder verkündete seine Sicht auf die Dinge. Die Gemüter waren erhitzt und eigentlich hörte keiner mehr dem anderen so richtig zu. Irgendwann ging man erschöpft auseinander.

Der Oberbürgermeister Bert Wendsche mit Matthias Hennl, dem Vertreter der Händlergemeinschaft, beim offiziellen Start des Sanierungsgebietes »Zentrum Radebeul-West« zum Frühlingsfest am 13. Mai 2017 auf der Bahnhofstraße Foto: Karin (Gerhardt) Baum
Wie schade, dachte ich, dass sich zur Zeit im Bürgertreff keine Bürger mehr treffen können, um sowohl miteinander als auch mit Fachleuten über die Entwicklung ihres Stadtzentrums zu diskutieren. Denn für Beratungen, Gesprächsrunden, Vorträge, Ausstellungen, Workshops sowie vielfältige kulturelle Veranstaltungen wurde der Bürgertreff ursprünglich von der Stadtverwaltung angemietet und dementsprechend ausgestattet. Stattdessen stellen sich in diesen Räumen Testläden vor und man fragt sich, warum testen die Testläden nicht die vielen leer stehenden Läden und arrangierten sich mit deren Vermietern?
Wenn also nicht im Bürgertreff, wo findet dann der Diskussionsprozess mit den Radebeuler Bürgern statt? Und wer wäre dafür zuständig? Und wo sind eigentlich all die kompetenten Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die viele eigene Ideen zur Entwicklung des Sanierungsgebietes beisteuern könnten? Ich denke dabei an die Fachbereiche Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung, Jugend und Soziales, Kultur und Tourismus, Ordnung und Sicherheit, Feste und Märkte. Gemeinsam mit einem Stadtmanager könnten sie doch den öffentlichen Diskurs mit Händlern, Bürgern und Eigentümern über das Sanierungsgebiet zielführend begleiten. Erregte Diskussionen auf der Straße oder wie eingangs geschildert im Netto-Markt tragen wohl kaum zur nachhaltigen Akzeptanz der geplanten Sanierungsmaßnahmen in Radebeul-West bei.
Dass in Radebeul-West ein massiver Umbruch stattfindet, ist unübersehbar. Während meiner dreijährigen Zusammenarbeit als Mitarbeiterin des Kulturamtes mit Kollegen aus verschiedenen Fachbereichen der Stadtverwaltung, der Oberschule Kötzschenbroda und den Händlern von Radebeul-West wurde ich mit den akuten Problemen vor Ort auf sehr direkte Weise konfrontiert. Gemeinsam haben wir im Zeitraum von 2015 bis 2017 u. a. vier Händlerspektakel und eine große Wunschbriefkastenaktion organisiert. Der Rücklauf war erfreulich. Und ich frage mich, was aus all den Ideen und Hinweisen werden soll. Kleine Erfolge konnten wir schon damals verbuchen. Endlich stand wieder ein Weihnachtsbaum auf dem Bahnhofsvorplatz, auf der Bahnhofstraße wurden bequeme Sitzbänke aufgestellt und in einem ehemaligen Ladengeschäft erfolgte die Eröffnung des Bürgertreffs. Während dieser Zeit habe ich viele Händler kennen und schätzen gelernt. Trotz aller Bemühungen wurden immer wieder Läden aus ganz unterschiedlichen Gründen geschlossen. Die Käse-Theke Hoffmann, das Haushalt- und Eisenwarengeschäft Lindner, Markos Lampenladen oder der Lebensmittelmarkt Müller seien hier beispielgebend genannt. Für viele Ladengeschäfte hat sich bis heute kein Nachmieter gefunden. Und wenn, dann sind es Branchen, die nur wenig zur Belebung der Einkaufsstraße beitragen. Besonders einschneidend war im vergangenen Jahr die Schließung des Drogeriemarktes Rossmann, da er als Frequenzbringer für die umliegenden Geschäfte sehr wichtig gewesen ist. Was nützt die originellste Sitzbank, wenn man auf tote oder blickdichte Fensterfronten schaut. Liegestühle, Stiefmütterchen und Luftballons – das alles ist rührend, macht die Einkaufsstraßen etwas bunter und die einheimischen Händler sympathisch. Straßen-Pflanzaktionen, Stadtteilfeste, Themenmärkte, Anzeigenschaltungen, Marketingstrategien, Rabattaktionen, Modenschauen, Schaufensterwettbewerbe oder Saison-Schlussverkäufe halten das Sterben der kleinen inhabergeführten Läden aber nicht auf. Ich kaufe ja auch nur das, was ich brauche und halte mich nur dort auf, wo es für mich einen Sinn ergibt. Eine Bürgerbefragung zum Einkaufs- und Freizeitverhalten der Radebeuler Bürger wäre da wohl ganz aufschlussreich. Trotzdem sollten sich die Händler nicht entmutigen lassen, weiterhin zusammenhalten und immer wieder ohne Schere im Kopf neue belebende Aktionen starten.

Der Erste Bürgermeister Dr. Jörg Müller (3.v.r.) und die Mitarbeiterin Anja Schöniger (Mitte) vom SG Stadtentwicklung beantworten im Bürgertreff die Fragen interessierter Bürger zum Sanierungsgebiet Foto: Karin (Gerhardt) Baum
Die Erwartungen der Kunden an die Händler sind hoch und nicht alle Wünsche lassen sich realisieren. Es genügt schon ein Taschenrechner, um herauszufinden, was dem Händler nach Abzug von Miete, Betriebskosten, Verbindlichkeiten für den Warenbestand, Steuern sowie sonstigen Beiträgen und Unkosten zum Leben bleibt. Die Gründe wer warum im Handel arbeitet sind unterschiedlich. Nicht selten bekam ich zu hören, dass man unter den heutigen Bedingungen wohl kein Ladengeschäft mehr eröffnen würde. Umso erstaunlicher ist es, dass sich dann doch immer wieder Enthusiasten finden, die leidenschaftliche Händler sind und das auch noch lange bleiben wollen in der Hoffnung, dass bessere Zeiten und viele kauffreudige Kunden kommen.
Aber welche Geschäftsideen hätten denn überhaupt eine realistische Chance? Die Ladenflächen sind klein und die Mieten sind hoch. Die meisten Vermieter denken in erster Linie monetär. Die Sicherung eines ausgewogenen Branchenmixes ist nicht ihre Aufgabe und kann von ihnen auch nicht geleistet werden. Das Risiko liegt allein beim Gewerbetreibenden. Und was gab es da nicht schon alles für tolle Ansätze mit Cafeteria in der Sparkasse, Boutiquen, Jugendmode, Geschenkartikeln, Spezialitäten, Blumen, Antiquitäten, Modeschmuck, Gebraucht-, Schreib- und Spielwaren, die über kurz oder lang gescheitert sind. Ein entscheidender Punkt ist, wie lässt sich das Risiko für Neustarter minimieren? Vier Wochen Pop Up Store reichen da vermutlich nicht aus. Also welche Art von Unterstützung brauchen die jungen Kreativen mit wenig Startkapital?
Das Einzelhandelssterben ist ein deutschlandweites Phänomen. Bestehen wird künftig, wofür es einen Bedarf gibt. Angebot und Nachfrage bedingen einander. Die Kunden sind nicht weg – sie sind nur woanders. Man begegnet sich heutzutage in den Gängen der großflächigen Discounter, Supermärkte, Fachmärkte und Vollversorger. Die Einkaufswagen sind gut gefüllt, was der Theorie, allein der Online-Handel sei an der ganzen Misere schuld, widerspricht.
Die großflächigen Märkte auf der grünen Wiese mit kostenlosen Parkplätzen und breit aufgestellten Sortimenten von billig bis Bio haben den Innenstadtbereichen erhebliche Kaufkraft entzogen. Wie gehen andere Städte damit um? Dank Google stößt man da auf sehr viele gute Beispiele.
Alles ist relativ. Im Vergleich z.B. mit Wahnsdorf oder Lindenau sieht es im Zentrum von Radebeul-West doch ganz gut aus. Hier vermisst man fast nichts. Waren des täglichen Bedarfs, Eisdiele, Sparkasse, Apotheke, Buchhandlung – alles noch da! Und was es hier nicht gibt, besorgt man sich in Dresden oder im Netz. Das Zentrum von Radebeul-West ist zwischen Weinhängen und Elbaue sehr schön gelegen und hat allerhand zu bieten: eine repräsentative Gründerzeitbebauung, breite Fußwege, Schatten spendende Bäume, eine gute Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz und den Elberadweg. Nur ein paar Schritte weiter in Altkötzschenbroda befinden sich sonnige Biergärten, kleine Kneipen, Kunst, Kultur und exklusive Läden. Also wo liegt das Problem?
Woran es eindeutig mangelt im Bereich der Bahnhofstraße, sind größeflächige Frequenzbringer, von denen die kleine Läden partizipieren können. Und nun wird es kompliziert. Obwohl die Zeitfenster für den Verkauf von Bahnhof und Post viele Jahre offen standen, fehlte wohl den Entscheidungsträgern der strategische Durchblick. Wer, wann, was versäumt hat, das herauszufinden ist müßig. Wie heißt es doch: Gemeinwohl geht vor Eigennutz. Spätestens hier scheiden sich die Geister. Der Pessimist wird zynisch, der Optimist wird ironisch. Gegenseitige Schuldzuweisungen sind unproduktiv. Zu spät ist zu spät! Und privat ist privat! Alles andere ist Wunschdenken und setzt die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer voraus. Im Besitz der Stadt befinden sich zur Zeit lediglich der Bahnhofsvorplatz, der Apothekerpark sowie öffentliche Fußwege und Straßen bzw. verschiedene Flächen, welche einmal für den „Schulcampus“ genutzt werden sollen.
Dass sich vier Schulen, zwei Horte und ein Schulclub in diesem ohnehin dicht besiedelten Gebiet befinden werden, ist nicht unwesentlich und wirft einige Fragen auf. Wo werden die vielen Kinder und Jugendlichen ihre Freizeit verbringen? Was bedeutet das für die immer größer werdende Bevölkerungsgruppe von Senioren, die im nahen Wohnumfeld fußläufig einkaufen, soziale Kontakte und den geistigen Austausch pflegen, sich bilden und informieren wollen?
Das Sanierungsprogramm steht unter dem Motto „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“. Hierfür wurden die Fördermittel bewilligt. Das Spannende hieran ist, welcher praktische Nutzeffekt sich daraus für die Radebeuler Bürgerschaft ergeben wird. Der Horizont sollte nicht zu eng abgesteckt werden, denn immerhin ist Radebeul-West eines von zwei Stadtzentren, die alters- und sozialübergreifend gedacht werden müssen. Es ist völlig kontraproduktiv, die Bahnhofstraße isoliert zu betrachten.
Im Sinne von Händlern und Kunden könnte z.B. durch die Wirtschaftsförderung ein gesamtstädtisches Informationsportal mit kurzen sachlichen Texteinträgen von allen Radebeuler Handels- und Dienstleistungseinrichtungen eingerichtet werden. Vielleicht ließe sich damit das bewusste Einkaufen vor Ort befördern. Denn oftmals mangelt es an Information. Häufig hört man: „Das es das hier gibt, habe ich gar nicht gewusst.“ Vor allem für die Neuradebeuler wäre dieser Service ein sehr nützliches Stück Willkommenskultur. Der Besonderheit unserer Stadt Rechnung tragend, sollte man auch viel mehr die Stärken von Radebeul-Ost und Radebeul-West herausstellen und damit das Interesse für beide Zentren wecken. Ein durchgängiger Radweg könnte hierzu verbindend beitragen.
In Kooperation von Händlerschaft und Stadtverwaltung wurde zur Entwicklung der Bahnhofstraße eine AG Leitbild gegründet. Die ersten Arbeitsergebnisse kann man in einer Leitbildbroschüre nachlesen. So will man z.B. unter dem Motto „Bahnhofstraße – das hat was“ ein neues „Wir-Gefühl“ vermitteln. Da ist u.a. die Rede von Co-Working-Spaces, Tiny Houses, Moonlight-Shopping, Pop Up Stores … Moment mal, bin ich mit 65 Jahren schon zu alt, um zu verstehen worum es hier eigentlich geht?
Ach übrigens, vorm Bürgertreff steht wieder ein Briefkasten für Wünsche, Ideen, Vorschläge und Kritik. Die Leitbildbroschüre habe ich allerdings im Bürgertreff vergebens gesucht. Gefunden habe ich sie dann im Internet.
Bevor mit der praktischen Sanierung begonnen wird, wäre es wohl wichtig, dass sich Händler, Bürger, Eigentümer, Vertreter der ortsansässigen Bildungseinrichtungen, Fachämter und Kommunalpolitiker noch einmal mit der komplexen Problematik kritisch auseinandersetzen, um eventuelle Interessenkonflikte bereits im Vorfeld zu minimieren. Der Optimist würde hier anmerken: Besser spät als nie. Die Entwicklung eines modernen, lebendigen und gut funktionierenden Stadtzentrums ist schließlich unser aller Ziel.
Karin (Gerhardt) Baum