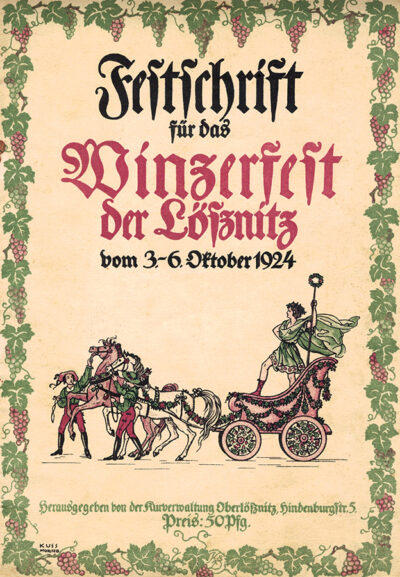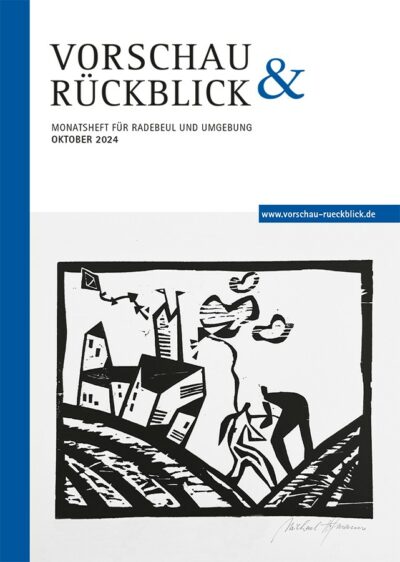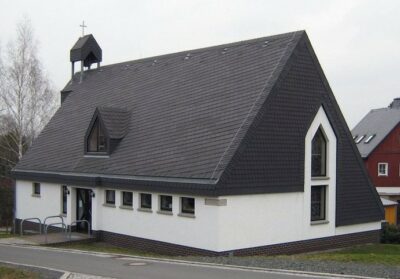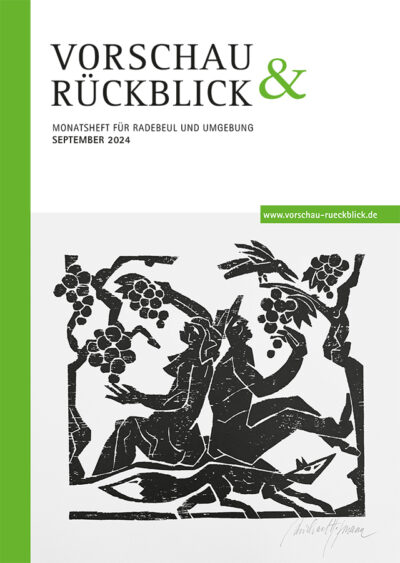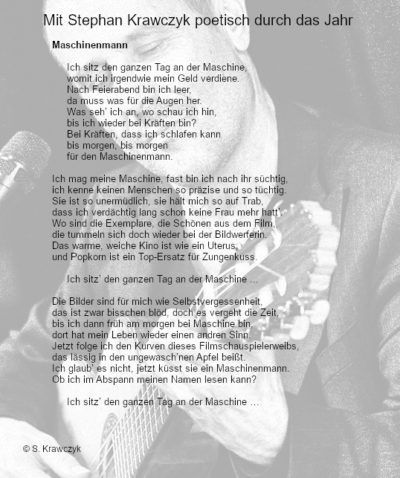Ein sehr persönlicher Nachruf auf Herbert Graedtke (*9.12.1941, +18.9.2024)
Im Sommer 1994 hatte mich Dietrich Lohse, Vater eines meiner engsten Schulfreunde, angesprochen und mich gefragt, ob ich denn nicht Interesse hätte, für „Vorschau & Rückblick“ zu schreiben. Schließlich sei ich als Student der Germanistik ja prädestiniert dafür. Bei meinem ersten Besuch in der Redaktion im September stellte ich der Runde aus erfahrenen Schreibern – darunter Wolfgang Zimmermann und Dieter Malschewski – die Frage, worüber ich denn überhaupt schreiben sollte? Wie denn ein Thema zum Schreiber käme – oder müsste dieser sich ein Thema etwa suchen? Ich kann den genauen Ablauf natürlich nicht mehr rekapitulieren, aber eines weiß ich: Dieter Malschewski hatte schließlich festgelegt, dass ich im Herbst einmal über eine Premiere an den Landesbühnen Sachsen schreiben sollte, ich möge doch bis zur nächsten Redaktionssitzung mal schauen, was mich anspräche. Mit diesem Auftrag versehen widmete ich mich dem Spielplan und stellte fest, dass im November die Premiere von Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“ anstünde. Von diesem Stück hatte ich schon gehört. Ich fand auch heraus, dass die Hauptrolle des Willy Loman Herbert Graedtke spielen würde, was mich sofort elektrisierte, denn dieser Schauspieler war nun wiederum der Vater eines weiteren sehr guten Freundes, Sascha Graedtke (der einige Jahre nach mir auch zur „Vorschau“ stoßen sollte und inzwischen verantwortlicher Redakteur ist). Ich hatte Herbert Graedtke in den Jahren zuvor das eine oder andere Mal getroffen, war als ein Freund seines Sohnes mit ihm bekannt gemacht worden. Manches Mal hatten Sascha, weitere Freunde und ich nach einer Aufführung an den Landesbühnen noch in der Theaterkneipe oder der „Goldenen Weintraube“ gesessen und über das gesehene Stück gesprochen, gelegentlich kam Herbert Graedtke dann zu uns jungen Leuten dazu und bereicherte die Runde mit Anekdoten und Kommentaren. Bei der Redaktionssitzung im Oktober 1994 schlug ich Dieter Malschewski deshalb vor, dass ich begleitend zur Premiere ja auch den Protagonisten interviewen und ein Porträt für das November-Heft 1994 verfassen könnte. Dieser Vorschlag wurde gelobt und so vermittelte mir mein Freund Sascha einen Besuchstermin bei seinem Vater. Am 12. Oktober 1994 betrat ich also aufgeregt das Haus des Schauspielers in der Niederlößnitz, was die Voraussetzung für meinen allerersten Artikel in „Vorschau & Rückblick“ war, der im Heft 11/94 unter dem Titel „Tod eines Handlungsreisenden oder das Leben eines Schauspielers“ erschien. In diesem Beitrag schlug ich einen biografischen Bogen und berichtete von Graedtkes Werdegang von den Anfängen im Berlin der Nachkriegsjahre, seinem Studium an der Filmhochschule Babelsberg ab 1960, seinen ersten Rollen in Zeitz und dann ab 1965/66 in Radebeul, seinen Ausflügen in den Film und wie er sich auf die bevorstehende Premiere vorbereitete.1
Damals, Mitte der 1990er Jahre, war Herbert Graedtke unter allen Schauspielern der Landesbühnen Sachsen derjenige, der am sichtbarsten in die Stadtgesellschaft Radebeuls ausstrahlte und mit seiner Lebens- und Gestaltungsfreude Menschen für Ideen begeisterte. Er war Mitbegründer des Fördervereins des Internationalen Wandertheaterfestival Radebeul und sein langjähriger Vereinsvorsitzender, das seit 1996 mit dem Herbst- und Weinfest in Kötzschenbroda eine harmonische Allianz eingegangen ist und dem Herbert Graedtke mehr als zwei Jahrzehnte als volksnaher Bacchus mit den Weinköniginnen an der Seite seinen Stempel aufdrückte. Einige Jahre zuvor, 1992, hatte er die Karl-May-Festtage mitbegründet und den berühmt gewordenen Sternritt initiiert, wobei ihm seine Verbindungen in die Karl-May-Fanszene zupass kamen, schließlich hatte Graedtke damals schon einige Jahre auf der Felsenbühne Rathen sowohl als Old Shatterhand agiert als auch ab 1987 Regie geführt. Auch das Karl-May-Fest überdauerte die Nachwendeeuphorie und ist inzwischen ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders in Radebeul und Pflichttermin für die zahlreichen Karl-May-Fans aus Deutschland und darüber hinaus. Kein Wunder, dass Graedtke dann 2006 für sein umfangreiches Engagement mit dem Kunstpreis der Stadt Radebeul geehrt wurde, bevor er im Sommer 2007 aus dem Ensemble der Landesbühnen ausschied und in den nächsten Jahren zahlreiche Engagements in der Theaterlandschaft Dresdens annahm, so u.a. an der Comödie Dresden und als Märchenerzähler in der Yenidze. Das letzte Mal, als ich Herbert Graedtke auf der Bühne erlebte, war im Juni 2019 in einer Inszenierung der „Lustigen Witwe“ an der damals gerade neueröffneten Staatsoperette Dresden im Kraftwerk Mitte. Ich merkte Herbert – längst duzten wir uns – an, dass er körperlich schon nicht mehr ganz der Alte war, ich wusste von gesundheitlichen Beschwerden. Meines Wissens markiert das Engagement als Gast an der Staatsoperette das Ende seiner fast 60 Jahre währenden Bühnenkarriere. Zwei Jahre später, Ende Mai 2021, hatte Herbert seinen wahrscheinlich letzten Auftritt vor großem Publikum, als ihn der Intendant der Landesbühnen, Manuel Schöbel, vor einer Neuinszenierung des „Winnetou“ auf der Interimsspielstätte im Lößnitzgrund für seine Verdienste als Mitwirkender bei Karl-May-Inszenierungen ehrte (siehe dazu auch mein Interview im Heft 7/2021).
Ich weiß nicht, wie ich damals vor 30 Jahren als junger Mann auf den weltgewandten, etablierten und renommierten Schauspieler gewirkt hatte. Danach hatte ich ihn nie befragt. Meinen Artikel musste ich vor Drucklegung Korrektur lesen lassen, das hatten wir so ausgemacht und das war mir als Neuling auch sehr angenehm. Schließlich wollte ich mich ja nicht blamieren! Unserem Treffen sollten noch etliche mehr im Laufe der nächsten 25 Jahre folgen, die allesamt im privaten Raum stattfanden, anlässlich von Familienfeiern oder aber auch zur gemeinsamen Weinlese. Immer erlebte ich Herbert als einen unterhaltsamen Gesprächspartner, der bereitwillig über sich und seine gerade einstudierten Rollen Auskunft gab. Sein leicht schnoddriger, berlinerisch gefärbter Dialekt kam in einem wunderbar weichen Timbre daher, mit seiner Stimme nahm Herbert Zuhörer für sich ein. Herrlich, mit wieviel Liebe er auch über seine Tiere sprach, jahrelang ließ er nahe des Bahndamms der Schmalspurbahn Schafe weiden, hatte er auch Tiere um sich zu Hause. Bewundernswert, wie er sich später im Unruhestand auch politisch engagierte und für die SPD im Stadtrat saß. Gesellschaftlich-politische Missstände wollte er verändern helfen, auch gegen Widerstände.
Herbert Graedtke hat also viele Spuren hinterlassen und unserer Stadt und seinen Bewohnern über Jahrzehnte mit seiner Ausstrahlung gedient und sein Publikum begeistert. Die Trauergemeinde anlässlich seiner Beisetzung am 23. Oktober auf dem Friedhof Radebeul-Ost war deshalb groß und ein Ausdruck des Respektes, den dieser verdienstvolle Mitbürger genießt. Neben ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, Lokalpolitikern und Künstlern war auch die Radebeuler Bürgerschaft insgesamt vertreten. Viele davon trugen ihre ganz persönlichen Gedanken an den Schauspieler, engagierten Mitbürger und Freund mit sich und verabschiedeten sich von einem Menschen, an dem man sich nur mit Dankbarkeit und einem Lächeln erinnern kann. Danke, Herbert, für deine Kunst und Menschenfreundlichkeit.
Bertram Kazmirowski