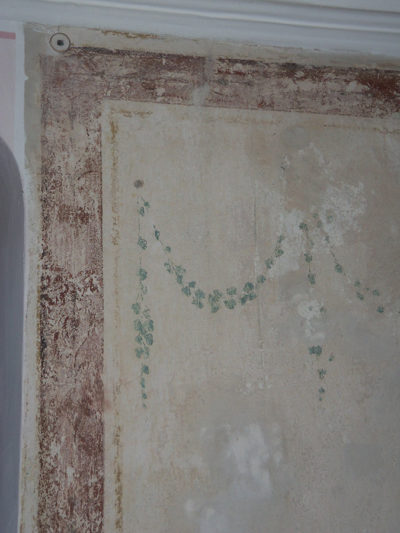Indem der Verein das Projekt Bismarckturm betreibt, hat er es sich auch zum Ziel gemacht, über Inhalte und Wirkungen von Turm und Person zu diskutieren. Wir geben daher an dieser Stelle einen redaktionell leicht bearbeiteten Auszug aus der diesjährigen Festrede zum 1. April, Bismarcks Geburtstag, gehalten von Herrn Falk Drechsel, wieder. Er widmete sich als Lehrer an einem Dresdner Gymnasium der praktischen Frage: Was bringt man der Jugend über Bismarck bei – und wozu? (Jens Baumann, Verein für Denkmalpflege und Neues Bauen Radebeul e. V.)
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Ausgewogenheit habe ich mich in einigen Lehrbüchern umgetan. So fand ich im Realienbuch meines Großvaters von 1911 zu Bismarck – recht wenig. Zwar ist ihm und Moltke unter der Überschrift „Zwei treue Diener ihres Königs“ ein eigener Abschnitt gewidmet, aber allein die Beschreibung der Schlachten von Königgrätz, Langensalza, Weißenburg, Wörth, Spichern, Mars la tour oder erst gar Sedan nehmen jeweils mehr Raum ein. Der Beginn des Abschnitts sei zitiert: Als er am 1. April 1815 zu Schönhausen an der Elbe geboren wurde, hatte in Frankreich eben Napoleons Herrschaft der „hundert Tage“ begonnen, die nach der Schlacht bei Belle Alliance wieder zusammenbrach. Der Wiener Kongreß war noch daran, die Verhältnisse in Europa zu ordnen. Er gab Deutschland weder den verdienten Länderzuwachs noch ein starkes Oberhaupt. Der ohnmächtige Frankfurter „Bundestag“ trat an die Spitze des vielgestaltigen deutschen Staatenbundes. Vor allen Dingen war Preußen für seine gewaltigen Leistungen im Befreiungskriege nicht die ihm zustehende Machtstellung bewilligt worden. So waren, als das Knäblein noch in der Wiege lag, schon die Ziele seines späteren Wirkens gegeben. Nach Vollendung seiner juristischen Studien verwaltete Bismarck zwei Güter seines Vaters in Pommern. Damit ist ein Drittel zu Bismarck geschafft, in ähnlichem Stil folgen die weiteren biografischen Stationen.
Bismarck erscheint also als Kind einer Zeit ungelöster Probleme, der quasi als Säugling die zu klärenden Fragen wie mit der Muttermilch aufnimmt und mit ihnen heranwächst. Aber auch als zielstrebiger Jugendlicher, zunächst ohne sichtbare politische Ambitionen, als selbstverständlich pflichtbewusster Sohn seines Vaters in Preußen. Ob das alles so stimmt, soll an dieser Stelle und auch im Folgenden gar nicht primär hinterfragt werden. Auffällig ist, dass der vielfach Bedenkmalte vermenschlicht wird, in die erfassbare Erlebenswirklichkeit der Schüler herabgeholt wird. Nicht als einer von ihnen, schon herausgehoben, aber greifbar, spürbar. Fast: normal im Sinne von: der Norm entsprechend. Und: wir können erkennen, was ihn als Menschen antreibt, und dass dies relevant ist.
Blicken wir in ein Geschichtsbuch aus Niedersachsen aus dem Jahre 1973. Die Aufmachung und das didaktische Konzept sind natürlich völlig anders, es gibt selbstredend keinen spezifischen Bismarck-Abschnitt, vielmehr wird Bismarck als roter Faden, als leitendes Prinzip einer ganzen Epoche betrachtet. Auch hier beschränke ich mich auf den Anfang der etwa 20 folgenden Seiten. Verlassen von den meisten seiner Minister, dachte der König daran, abzudanken; doch der Kriegsminister wußte Rat. Eilends rief er seinen Jugendfreund Otto von Bismarck herbei, der gerade als Gesandter in Paris weilte. Diesem gelang es, den König zu überzeugen, „daß es sich für ihn … um Königliches Regiment oder Parlamentsherrschaft handle und daß letztere notwendig auch durch eine Periode der Diktatur abzuwenden sei.“ Der König dankte nicht ab, und Bismarck wurde Ministerpräsident. Gegenüber den Abgeordneten vertrat Bismarck uneingeschränkt die Forderungen seines Königs; alle Vermittlungsversuche wies er hochmütig ab. Die folgenden Überschriften lauten z.B. Unter dem Druck der „öffentlichen Meinung“, Gesellschaft und Staat unter Bismarck, Bismarck sichert das Reich, Sicherheit durch Abschreckung, Sicherheit durch Bündnisse.
Bismarck als politisches Phänomen, Bismarck als Vorgang, als Untersuchungsgegenstand theoretischer Erörterungen mit langwierigen Argumentationsketten, schlimmstenfalls vielleicht sogar herhalten müssend als Gaul der Steckenpferdparade eines einer geisteswissenschaftlichen westdeutschen Universitätsfakultät jüngst entschlüpften Jungachtundsechzigers.
Wer einen derartigen Geschichtsunterricht erlebt mit seiner faden Blutleere, bei dem wundert’s mich nicht, dass er sich ein paar Jahre später mit „Ein bisschen Frieden“ zufrieden gibt und „Da Da Da“ als repräsentativ für die verbale Entäußerung von Hedonismus angesehen werden kann. Auf solche Weise sind Resignation und Nihilismus vorprogrammiert, und für Empathie bleibt da wenig Platz.
Lassen Sie mich schließlich noch aus einem DDR-Lehrbuch zitieren. In der spätestens nach 1952 streng zentralisierten DDR gab es nicht nur ein einheitliches sozialistisches Bildungssystem, sondern jeweils auch nur ein landesweites Lehrbuch, welches dann immer für etwa 10, 12, 15 Jahre nahezu unverändert in Gebrauch war. Die Geschichtslehrbücher der 50er Jahre waren die der „Roten Reihe“, benannt nach ihrer Einbandfarbe (und sicherlich auch wegen ihres Inhalts). Um nicht abzuweichen, auch hier wieder der Beginn der Bismarck-Behandlung: Der König berief auf Anraten der Junker und der Militärs Otto von Bismarck an die Macht, von dem Wilhelm I. wußte, daß er nicht davor zurückschrecken würde, auch ohne Parlament zu regieren. Bismarck wurde am 23. September 1862 zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt. Otto von Bismarck (1815 bis 1898) entstammt einer altmärkischen Junkerfamilie. Er studierte Rechtswissenschaft. Da ihm die juristische Beamtenlaufbahn nicht zusagte, übernahm er die Verwaltung seines Gutes in Pommern. Bismarck begann seine politische Tätigkeit als Abgeordneter des preußischen Landtages. Hier schon zeigte er sich als der reaktionäre preußische Junker, dem die Demokratie verhaßt war. 1851 vertrat er Preußen auf dem Frankfurter Bundestag als Gesandter. Später ernannte ihn der König zum preußischen Botschafter am Hofe des Zaren in Rußland und am Hofe Napoleons III. in Frankreich. Er war ein eifriger Verteidiger der Interessen der preußischen Junker und der geschworene Feind der Arbeiter und Bauern.
Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, dass in diesem Abschnitt (und das setzt sich so auch fort) zwei Worte besonders häufig fallen: Junker und Preußen. Man bezeichnet solches als „Hochworte“, in diesem Falle sind es „Negativ-Hochworte“. Nicht nur durch den die ostdeutsche Bodenreform nach 1945 kennzeichnenden, in den 1950er Jahren noch immer allgegenwärtigen Slogan „Junkerland in Bauernhand“, sondern durch Filme, Zeitungstexte, Agitationsveranstaltungen und vieles mehr war der Begriff des „Junkers“, mit dem die Menschen in Sachsen, Thüringen und Anhalt zudem kaum etwas anfangen konnten, durchweg negativ konnotiert – ebenso wie der Begriff „Preußen“. Formulierungen wie „am Hofe des Zaren“ und gleich danach „am Hofe Napoleons III.“ sowie kontrapunktisch „geschworener Feind der Arbeiter und Bauern“ tun ein übriges, um Bismarck als mächtiges und „eifriges“ Werkzeug der Reaktion zu erfassen, von dem im Fortgang auf alle Fälle nichts Gutes zu erwarten sei. Die Linie ist damit vorgegeben, und alles Weitere ist unter dieser Prämisse zu betrachten. Geschichte als Hure marxistisch-leninistischer Totalitätsideologie.
Es treten uns hier am Beispiel der Betrachtung oder auch Benutzung Bismarcks drei Geschichtsbilder1 entgegen, die wiederum Teil eines jeweiligen Geschichtsbewusstseins sind und dieses maßgeblich mit konstituieren. Geschichtsbewusstsein ist immanenter Bestandteil des gesellschaftlichen Bewusstseins und dieses bedingt tatsächlich gesellschaftliches Handeln.
Betrachte, vermittle ich Bismarck als Vorgang, als Prinzip, entmensche ich ihn. Dann vernachlässige ich, dass Geschichte von Menschen gemacht wird und eben nicht nur ein logischer Ablauf von Kausalitätsprozessen ist, dessen Protagonisten austauschbar wären. Wird Geschichte von Menschen gemacht, dann handeln diese gemäß ihrer menschlichen Natur: vernünftig, pragmatisch, werteorientiert, klug oder weniger klug, charismatisch oder auch nicht, häufig aber eben auch, gottlob, emotional. Das können wir kritisieren im konkreten Falle, dazu können wir Alternativen aufzeigen günstigerweise, das kann uns zu viel werden oder falsch sein in der Wichtung – aber wir sollten es, wir müssen es akzeptieren.
Wenn ich bei Bismarck eben nicht aufhöre nach dem „Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts auf der Welt“, sondern fortsetze mit seinem „und die Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und pflegen lässt“, dann bin ich bei Werteorientierung. Wenn ich darstelle, dass zu Otto von Bismarck eben auch seine Frau Johanna gehörte und beide eine wohl sehr innige Liebe verband, werden auch Obrigkeitspolitiker menschlich. Das muss nicht in Voyeurismus, Anekdotismus oder Kitsch ausarten. Handeln erklärt sich so aus Liebe zum Vaterland, persönlichen Veranlagungen, Überzeugungen, Wissen, Respekt, Redlichkeit, Weltgewandheit und dem Wissen, man ist nicht allein – Bismarck z. B. suchte den Ausgleich mit Russland und ist schon daher, wie oft aus in völliger Unkenntnis postuliert, kein Vorläufer nationalsozialistischer Denkweisen.
Und somit hege ich die Hoffnung, dass Bismarck im Geschichtsunterricht nicht nur gut ist, zur Erhellung der Vergangenheit beizutragen, sondern auch unser Verhalten in der Gegenwart ein wenig zum Positiven zu beeinflussen. Und dann hört es vielleicht endlich auf, dass Politiker als „Birne“ bezeichnet oder mit Farbbeuteln beworfen werden, dass ihnen entmenschte Praktiken unterstellt oder verächtlichmachende Sexualattribute zugestanden werden, dass wir ihren Gang durch eine Kunst- und Kulturstadt unter nachgemachte Tiergeräusche stellen oder sie auf Demonstrationsplakaten mal schnell an einen Galgen hängen. Und dass diejenigen, die sich selbst als Hüter und Kontrolleure der sozialen Ordnung akzeptiert sehen wollen, das, je nach eigenem politischen Wahrheitsanspruch, schließlich unter das Postulat „Meinungsfreiheit“, „Kunst“ oder „Satire“, welche vermeintlich alles dürften, stellen.
Unter unserem politisch unstrittigen Grundkonsens der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gibt es noch einen. Diesen hat meine Generation von den Eltern oft gehört und vorgelebt bekommen. Er ist ein ganz Einfacher: „Sowas macht man nicht“. Wenn wir diesen Grundsatz bedenken, dann kommen wir immer wieder dazu, den andern, wer es auch sei und was und wie er auch sei, als Menschen zu betrachten.
Jens Baumann