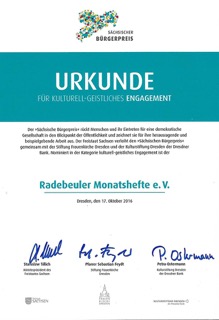Du musst Träumen ihre Entstehung zulassen, denn nur so kann irgendwann ein Teil davon auch Wirklichkeit werden.
EPILOG – Herr Tagtraum und das allweis(s)e Sternenschiff
Viele, sehr viele Jahre sind vorüber. Stell dir vor, wir schreiben das Jahr, na, sagen wir, Zweitausendännafännuffzig. Aus Kindern sind Eltern, Groß- und sogar Urgroßeltern geworden. Aus Träumen sind neue Träume entstanden, weil, tja, eben nicht alle sich erfüllt haben. Manche sind auch komplett schief gegangen oder von der Wirklichkeit in eine ganz andere Richtung gedrängelt worden. Aus dem Heute heraus weiß keiner so genau, was bis zum Jahr Zweitausendännafännuffzig so alles erfunden sein wird und in welcher Verfassung sich dann unsere gute, alte Erde und die gesamte Menschheit befinden wird, denn, das einzige, auf das Verlass ist, ist, dass sich alles ändert. Gestern – heute – morgen, einen Halt, ein Festhalten gibt es immer nur im Augenblick und in der Hoffnung, der Gewissheit, weiter gehen zu müssen. Aber stellen wir uns mal einen schönen, spätwarmen Herbsttag im Oktober des Jahres Zweitausendännafännuffzig vor. An einem grünen, dreieckigen Haus werden tatsächlich Straßenbahnen vorbeifahren, eine Haltestelle befindet sich unmittelbar vor der Eingangstür. Vielleicht ist die Straßenbahn dann auch noch gelb, quietscht aber kein bisschen mehr, weil sie tatsächlich weder Schienen noch Oberleitung braucht, sondern auf einem Luftkissen angeschwebt kommt. Der Traum, dass eine S-Bahn vom Hauptbahnhof hier stoppt, um als nächste Station das Haus auf dem Weinberg anzusteuern, der hat sich natürlich auch erfüllt, nur nicht hier, sondern in Prag, Paris und Sao Paolo. Leider haben Unwetter, Vulkanausbrüche, Brände und Beben die Erde immer wieder heimgesucht, aber alle großen Kometen und Asteroiden sind immer nur knapp, also einige zehntausend Kilometer entfernt, an der Erde vorbeigesaust, die ganz große Katastrophe ist also ausgeblieben. Trotz allem, was immer wieder „Fortschritt“ genannt wird, ist die Menschheit nicht von Krankheiten verschont geblieben und auch nicht so vernünftig geworden, dass Kriege ausbleiben konnten. Und Wohlstand für alle Menschen? Die Erde hätte schließlich genug Ressourcen dazu, diesen mit dem Vernunftteil des menschlichen Gehirns zu ermöglichen, und es wäre schön zu sagen –
„Stelle dir das einfach mal vor!“ Aber mit dem Teil des Gehirns, in dem Gier, Hass und Neid wohnen…, nein, auch in vielen Jahren scheint das alles nicht so recht vorstellbar.
Ach, würde ich mich nur täuschen! Würde im Jahre Zweitausendännafännuffzig jemand diesen Text lesen und sagen: „Wie konnte der sich bloß so irren!“ Alle Welt lebte friedlich miteinander und die Menschheit hätte einen bleibenden Wohlstandsausgleich geschaffen. Magst du daran glauben oder davon träumen?
Um die Erde kreist ein allweis(s)es Sternenschiff. Das Sternenschiff scheint verlassen und leer, aber das täuscht, denn es ist voller Gedanken, Ideen und Erinnerungen. Seine Fenster geben den Blick auf die Erde frei, auf viele Sonnenauf- und -untergänge in ganz kurzer Zeit. Noch mag es sich von dem faszinierenden Blick auf die Erde nicht lösen. Für einen Weiterflug in die Tiefen des Alls bedürfte es eines gewaltigen Schubes…
An jenem spätwarmen Herbsttag im Oktober Zweitausendännafännuffzig sitzt im kleinen Park beim Theater ein alter Herr mit Hut und Mantel tagträumend auf einer Bank. Mit einer quietschgelben Straßenbahn begannen unsere Geschichten und – wie gesagt – eine Straßenbahn gibt es hier ja wirklich. Der alte Herr aber ist die zwei Haltestellen von seiner Wohnung zum Park gelaufen, sogar über Umwege. All diese Umwege stecken für ihn voller Erinnerungen, denn es sind von ihm oft begangene Wege. Herr Tagtraum beobachtet die Leute von seiner Parkbank aus, freut sich besonders über die Kinder, die jetzt aus der Schule kommen, erinnert sich wieder an den Geruch der Pausenbrote, damals, in einem schweren Schulranzen aus Leder, voller Bücher und Hefte. Mitunter ist Herrn Tagtraum etwas schläfrig und er nickt auf der Bank im kleinen Park ein wenig in den Schlummer. Dann träumt ihm von weiten Wegen, Wiesen, einem Flug über die Alpen, den Wellen am Meer und von einem Sternenschiff, das direkt über der Stadt schwebt und vielleicht sogar ihn und all die Menschen ringsum beobachten kann. Tatsächlich steht in der Zeitung etwas vom Kometen Singflurhallytour, der dieser Tage an der Erde vorbeizieht, leicht mit bloßem Auge zu erkennen. Astronomen haben nicht nur seine Masse und die Länge seines Schweifs berechnet, nein, auch seine Bahn. In genau 3 Millionen Jahren käme er hier an gleicher Stelle wieder vorbei… Es ist schon später Nachmittag geworden. Herr Tagtraum schaut auf seine alte Armbanduhr aus rötlichem Gold. Die hat schon viele Kratzer und auch nicht mehr das richtige, ursprüngliche Armband. Herr Tagtraum hat es durch ein einfaches, praktisches, mit weißen und roten Streifen und vielen Sternen ersetzen lassen. Der Sekundenzeiger der Uhr ist irgendwann hängen geblieben und steht ständig auf „zehn nach“, aber das stört Herrn Tagtraum nicht. Das Besondere an der Uhr ist nämlich das Zifferblatt. Da reichen sich zwei Männer in sehr altmodischen Sternenschifffahreranzügen die Hand. Der eine lächelt geradezu bezaubernd. Er soll der erste Mensch gewesen sein, der vor vielen Jahrzehnten die Erde für einen Flug ins All verlassen hat. Der andere Herr schaut etwas bedächtiger und blickt dabei auf seine Füße. Er soll auch der erste Mensch gewesen sein, jener, der den Mond betrat. Beide haben sich in Wirklichkeit nie getroffen. Nur auf dem Zifferblatt der alten Uhr von Herrn Tagtraum stehen sie sich Hand in Hand und von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Es ist Zeit für den alten Herrn in Hut und Mantel, Herr Tagtraum nimmt seinen Gehstock, stützt sich von der Bank und begibt sich auf den Weg nach Hause. Wiederum nimmt er nicht die Straßenbahn, wieder läuft er Umwege durch seine Erinnerungen. Und: Er wird bald DA sein. Wer ihn beobachtet wird feststellen, dass sein Gesicht, ja seine ganze Gestalt vor Zufriedenheit strahlt. Der Nachhauseweg fällt ihm leicht.
Und für den Autor dieser Geschichten wird es jetzt auch Zeit, nämlich sich an dieser Stelle von dir zu verabschieden. Du weißt ja – was immer geschieht, du darfst nie aufhören zu träumen und zu sagen „stelle dir vor…“. Und vielleicht stellst du dir ja vor, was man in Zukunft so vieles noch berge-, ja weltenversetzend besser machen muss. Deshalb mein inniger Wunsch mit auf DEINEN eigenen und einzigartigen Weg: Viel Glück und gute Begegnungen.
Solltest du Tom treffen, nun, mitunter bedarf es einer praktischen Handreichung aus den Träumen heraus in die Wirklichkeit. Meistens aber reicht schon ein wissendes Augenzwinkern…!
Tobias Märksch