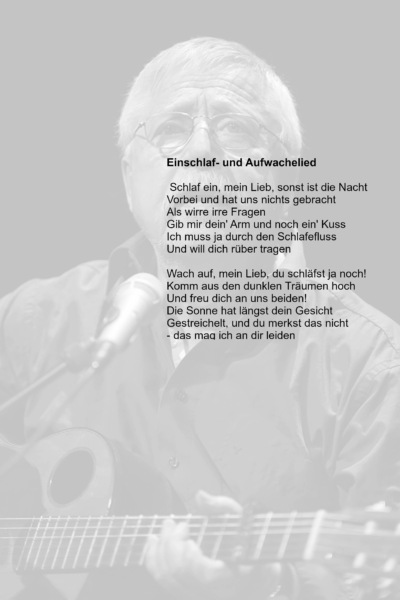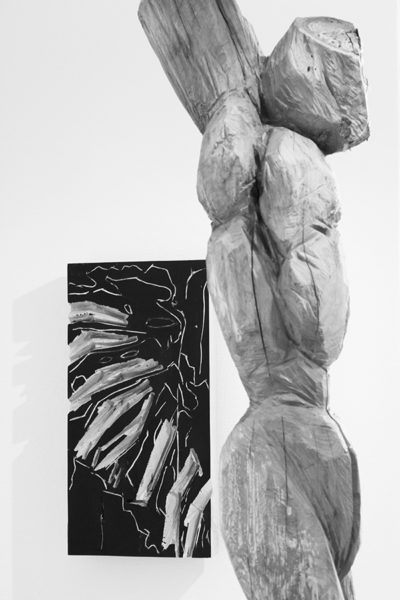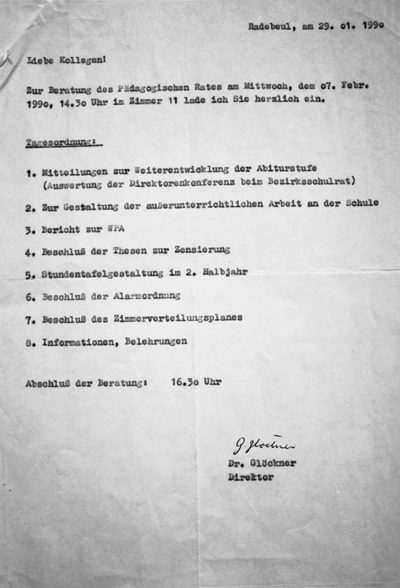Kunst geht in Gärten
18 Stationen, 85 Künstler
11. und 12. Juli 2020
Seit jeher sehnen sich die Menschen nach Austausch und Kultur. Vieles, was uns bisher als selbstverständlich erschien, war durch den Ausbruch der Corona-Pandemie plötzlich nicht mehr möglich. Das Virus führte auch im kunst- und kultursinnigen Radebeul zu Stille und Isolation. Doch allmählich kehrt das Leben in den öffentlichen Raum zurück und es ist Zeit für neue Sinneseindrücke. Die Denkpause wurde vielfach genutzt, um Ideen reifen zu lassen und kulturelle Impulse zu setzen. So hat die Stadtgalerie Radebeul gemeinsam mit dem Radebeuler Kultur e.V. unter dem Motto „Kunst geht in Gärten“ eine neue Veranstaltungsreihe initiiert. Künstler, Radebeuler Gartenbesitzer, Winzer und Kulturschaffende haben sich nun vernetzt und starten ein ungewöhnliches Experiment aus Tradition, Fantasie und Lust an Improvisation. Ein Orientierungsplan verbindet 18 Stationen, die sich über ganz Radebeul verteilen. Gärten erzählen ihre Geschichte, laden zum Verweilen und anregenden Gesprächen ein. Natur und Kunst verbinden sich zu einer Symbiose. Malerei, Grafik, Plastik, Fotografie und Installation werden in ungewohnte Zusammenhänge gesetzt. Wandermusiker ziehen von Ort zu Ort. Performanceaktionen sowie vielfältige kulturelle Darbietungen tragen zur Belebung bei. Die rege Mitwirkungsbereitschaft aller Beteiligten hat die kühnsten Erwartungen übertroffen. Dafür sei herzlich gedankt. Trotz der noch immer notwendigen Abstandsregeln freuen wir uns auf ein lebendiges, achtsames Miteinander.
Stationen
1 Elbe
„TERROIR“ Aktionskunst
Tobias Wolf
herkulisches Ringen mit der Elbe
im größten Garten von Radebeul
SA 10-18 Uhr, SO 10-18 Uhr
Elbufer Altkötzschenbroda, Kontakt: 0172-3471023
2 Stadtgalerie Radebeul
Bernd Hanke „RÄUME & DINGE“ Fotografik
SA 14-18 Uhr, SO 13-17 Uhr
SA Performance: Klaus Liebscher
Altkötzschenbroda 21, Kontakt: 8311625
3 Hof Atelier Oberlicht / Kunstpasssage
„FreiArt“ – Kunst unter freiem Himmel
Regina Baum, Simone Ghin, Sabine Herrmann,
Frank Mehnert, Markus Retzlaff, Renate Winkler
Malerei, Grafik, Objekte, Keramik
SA 13-18 Uhr, SO 13-18 Uhr
Altkötzschenbroda 23, Kontakt: 0172-3030173
4 Café grünlich
Frank Hruschka
Malerei, Grafik
Musik: Mrs Columbo
SA 13-18 Uhr, SO 13-18 Uhr
Altkötzschenbroda 25, Kontakt: 8386888
5 Alte Molkerei
„Molke Open Studios 2020“
Johannes Flechtenmacher, Manuel Frolik, Nora Herrmann,
Franziska Hoffmann, Sophia Hoffmann, Thomas Judisch,
Kax Mowalewski, Moritz Liebig, Stephanie Lüning,
Simon Mann, Roswitha Maul. Frank Zitzmann
Einzelarbeiten, Installationen
SA 13-19 Uhr, SO 14-18 Uhr
SO 16:30 Uhr live: DRESDNER GNADENCHOR
Fabrikstraße 26, Kontakt: 0162-6883813
6 Kunsthaus Kötzschenbroda
„Insekten, Viren, Mauerblümchen & Exoten“
Christiane Latendorf, Gabriele Schindler,
Matthias Kistmacher, Matthias Kratschmer,
Ingo Kuczera, Pseudo 1, Pseudo 2
Malerei, Keramik, Objekte, Installationen, Kunstaktion
SA 15/16 Uhr „Märchenhafte Lieder aus liederlichen Märchen“
Wolf-Dieter Gööck (Gesang und Saiteninstrumente)
Max Lorenz (Gesang, Saiteninstrumente und Percussion)
SO 15/16 Uhr Die Affen
Ole Sterz (Mandoline, Geige)
Marie Luise Herrmann (Gesang, Akkordeon)
Georg Bergmann (Bass, Gesang)
Björn Reinemer (Percussion, Gesang)
SA 15-18 Uhr, SO 15-18 Uhr
Käthe-Kollwitz-Straße 9, Kontakt: 0160-2357039
7 Garten Atelier Mittag
Johanna Mittag, Ju Sobing
Malerei, Grafik, Objekte
Musik: Henriette und Johanna Mittag (Bratsche, Geige)
SA 13-18 Uhr
Bodelschwinghstraße 1, Kontakt: 0170-3859478
8 Garten Atelier Schulze
Annerose Schulze, Fritz Peter Schulze
Objekt, Plastik
SA 13-19 Uhr
Finstere Gasse 7, Kontakt: 8387425, 0173-3687169
9 Galerie mit Weitblick
Thorsten Gebbert, Horst Hille,
Dorothee Kuhbandner, Friedrich Richter
Malerei, Grafik, Keramik, Kleinplastik
Stille und Kuchen im Brunnen
Mitmachaktion am SA: Seifenherstellung
SA 13-18 Uhr, SO 13-18 Uhr
Obere Bergstraße 13, Kontakt: 0174-1471270
10 Garten Atelier Konheiser
Cornelia Konheiser
Malerei, Grafik
SA 14-18 Uhr
Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße 12, Kontakt: 8389081
11 Garten Atelier Reinemer
Gabriele Reinemer, Detlef Reinemer
Plastik
SA 14-18 Uhr
Bennostraße 15, Kontakt: 8301159, 0174-4721864
12 Weingut Drei Herren
Joachim Rauch
Malerei
SA 12-21 Uhr, SO 12-21 Uhr
Weinbergstr 34, Kontakt: 0171-5248000
13 Sächsisches Weinbaumuseum Hoflößnitz
„Unter demselben Blau, über dem nämlichen Grün“
Dietmar Kunze
Zeichnungen
SA 10-18 Uhr, SO 10-18 Uhr
Knohllweg 37, Kontakt:8398331, 0179-6674718
14 Café am Spitzhaus
Mechthild Mansel
Malerei
Besenwirtschaft Gebr. Lorenz / Wein F. Fourré
Tel: 0174-4956398
SA 13-18 Uhr, SO 13-18 Uhr
Spitzhausstraße 40, Kontakt: 0179-6790863
15 Terrasse Wilhelmshöhe
Sophie Cau, Jens Gebhardt, Karen Graf, Peter Graf, Klaus Liebscher,
Karola Smy, Wolfgang Smy, Claus Weidensdorfer+, Irene Wieland
Malerei, Grafik
Performance: „Quintravers“ (Flötenquintett)
Action Painting: Klaus Liebscher
Schlußakt: Künstlerin bemalt Künstler
Musik: Hartmut Dorschner,
Katharina Sommer, Günther Baby Sommer, Irene Wieland
SO 14-20 Uhr
An der Wilhelmshöhe 10, Kontakt: 8308601, 0177-2952652
16 Garten Atelier Wieland
Plastik, Malerei, Performance mit den Künstlern
der KUNSTSPUREN: Uwe Beyer, Sophie Cau, Silvia Ibach,
Gabriele Kreibich, Klaus Liebscher, Peter PIT Müller,
Anita Rempe, Gabriele Seitz, André Uhlig, Ralf Uhlig,
Anita Voigt, Irene Wieland, Bettina Zimmermann
Kunstspuren suchen Naturspuren,
Nähmaschine rattern für „Quintravers“ im Farbrausch
SA 13-18 Uhr
Meißner Straße 57, Kontakt: 8309452
17 Lügenmuseum
„Shutdown“ Exibition
Kurt Buchwald, Sophie Cau, Justus Ehras, Lutz Fleischer,
Richard von Gigantikow, Klaus Liebscher, Gabriele Reinemer,
Katrin Süss, Juliane Vowinkel, Dorota Zabka
Außerdem: Livestream und Sankt-Nimmerleins-Garten
SA 13-18 Uhr, SO 13-18 Uhr
Kötzschenbrodaer Straße 39, Kontakt: 0176-99025652
18 Garten Atelier Uhlig
„Bilderfindung im Garten“
Ralf Uhlig
Grafiken, Collagen
Janek Uhlig
Graffiti mit Schablonentechnik
SA 15-18 Uhr, SO 11-18 Uhr
Straße des Friedens 49, Kontakt: 8308760
19 Wandernde Musiker
SA Micha Winkler (Posaune)
SA und SO Robert Hennig (Akkordeon, Klarinette, Geige)
Gabriel Jagieniak (Akkordeon, Gesang)
Antonio Lucaciu (Saxofon)
HINWEISE
Der gedruckte Flyer ist ab Anfang Juli im
Radebeuler Kulturamt und weiteren Auslagestellen erhältlich.
Die Besucher bringen ihr eigenes Glas und wer will,
das eigene Picknickkörbchen mit.
Getränke sind vor Ort erhältlich.
Die Standorte von öffentlich nutzbaren Toiletten
sind besonders gekennzeichnet.
Eintritt frei.
Die Künstler freuen sich über eine Spende in den Hut.
Achtung: Im Orientierungsplan wurden die Nummern 8 und 10 vertauscht.
Flyer zum Download
Von der Kunst mit Kunst in Gärten zu gehen