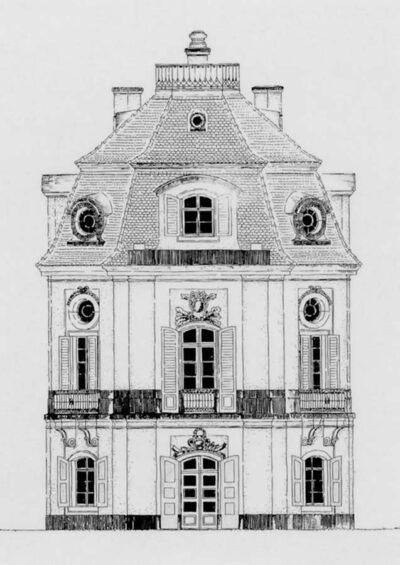Förderpreis Heimatforschung für Karl Uwe Baum
Bereits im November vergangenen Jahres erhielt das Redaktionsmitglied von Vorschau und Rückblick Karl Uwe Baum den vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus und vom Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V. vergebenen Förderpreis des „Sächsischen Landespreises für Heimatforschung 2020“ zugesprochen. Mit Karl Uwe Baum sprach Karin (Gerhardt) Baum.
Zunächst möchte ich dir im Namen der Redaktion für die Auszeichnung herzlich gratulieren. Nun sind seit der Ehrung schon einige Monate vergangen. Hat sich die Freude bereits gelegt?
Die Auszeichnung hat mich natürlich schon überrascht, auch wenn man mit der Teilnahme an so einem Wettbewerb dies erhofft. Mein eigentliches Ziel aber war, das Thema „Geschichte des nichtprofessionellen Theaters“ besser in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist gelungen und insofern hält die Freude auch heute noch an.
Kannst Du uns das genauer erklären?
Gern. Ausgezeichnet wurde ja die von mir seit 2017 betriebene Homepage www.amateurtheater-historie.de. Bis Oktober vergangenen Jahres haben im Schnitt rund 1.800 Nutzer monatlich auf die Seite zugegriffen. Nun ist ja die Geschichte des nichtprofessionellen Theaters kein besonders populäres Gebiet. Man kann es eher als ein „Orchideenfach“ bezeichnen. Regelrecht unzufrieden war ich also nicht. Aber es lag mir schon daran, mein Anliegen stärker bekannt zu machen. Nach der Veröffentlichung der Auszeichnung stiegen die Zugriffe auf die Seite mit weit über 11.000 auf das Sechseinhalbfache im Monat. Darüber hinaus haben sich auch Bürger gemeldet, die mir Informationen und Material angeboten haben.

Szene aus Des Teufels goldene Haare von Gernot Schulze, gespielt vom Arbeitertheater der Bauarbei-ter Dresden mit Karin Bräuer als Hexe Igittigitt und Uwe Baum als Räuber Bums 1980
Bild: Archiv Baum
Das Verrückte ist, dass dieses Theater in der Freizeit zu allen Zeiten in großer Zahl, besonders auch in Sachsen, gepflegt wurde und wird, aber in der Geschichtsschreibung der letzten 30 Jahre wie auch in Archiven und Museen nur in geringem Maße anzutreffen ist. Das hängt auch mit der Besonderheit des Metiers zusammen. Ein Theater, und sei es nur ein Amateurtheater, zu betreiben, ist teilweise kostenintensiv sowie ungeheuer zeitaufwendig und verlangt auf vielen unterschiedlichen Gebieten Kenntnisse. Für die Dokumentation bleibt dann oft keine Zeit und Kraft mehr. Auch haben Kriege, Katastrophen sowie gesellschaftliche Umbrüche den Archivbeständen stark zugesetzt.
Wer sich aber mit diesem Gebiet einmal näher beschäftigt hat, wird feststellen, dass dieses nichtprofessionelle Theater über Jahrhunderte hinweg eine große kulturelle Leistung in der Gesellschaft vollbracht und so wesentlich zu deren Funktionieren und Herausbilden beigetragen hat. Sachsen kann man als ein „Mutterland des nichtprofessionellen Theaters“ bezeichnen.
Mit meiner Homepage aber auch mit meiner Sammlung will ich ein wenig dazu beitragen, dass das Wissen und die Kenntnisse um diese Freizeitbeschäftigung nicht verloren gehen.
Auf deine Antwort fallen mir jetzt sehr viele Fragen ein… Du hast Sachsen als das „Mutterland des Amateurtheaters“ bezeichnet, wie muss man das verstehen?
Die Geschichte des nichtprofessionellen Theaters ist ja noch nicht erforscht. Da tut sich die Wissenschaft schwer. Sicher auch aus den von mir genannten Gründen. In Sachsen sind wir erfreulicherweise in der Lage, diese Geschichte bis ins 14. Jahrhundert konkret zurückverfolgen zu können. So weiß man, dass 1322 in Eisenach – damals noch zu Sachsen gehörig – das geistige Schauspiel von den klugen und unklugen Jungfrauen durch Mönche und Schüler zur Aufführung gelangte. Mindestens seitdem ist das Theaterspielen durch Menschen aus dem Volk in Sachsen nicht mehr wegzudenken. Im 19. und 20. Jahrhundert entwickelte sich dieses Bedürfnis dermaßen, dass die nichtprofessionelle Theaterszene zu den stärksten im Deutschen Reich und der Weimarer Republik zählte. Auch in der DDR führten die drei sächsischen Bezirke das Feld der Amateurtheater nicht nur zahlenmäßig an.
Du hast dich offensichtlich gründlich mit diesem Gebiet beschäftigt. Wie bist du dazugekommen?
Der DNN-Beitrag ist darauf schon ausführlich eingegangen, deshalb nur eine kurze Antwort. Ich habe natürlich vor langer Zeit selbst in einem Amateurtheater gespielt und von 1990 bis 2013 den sächsischen Verband für Amateurtheater geleitet. Von daher war ich schon länger auch an deren Geschichte interessiert. So konnte ich u.a. im Neuberinmuseum in Reichenbach (Vogtl.) Anfang der 1990er Jahre ein Archiv für Amateurtheater initiieren. Der eigentliche Auslöser aber folgte reichlich 10 Jahre später. Im Landesverband war die Überzeugung gereift, selbst eine Publikation zur Geschichte des sächsischen Amateurtheaters herausgeben zu müssen. An diesem Unternehmen, an dem ich maßgeblich beteiligt war, haben wir fünf Jahre gearbeitet. Herausgekommen ist dann die Publikation Auf der Scene 2013, die heute in vielen Hochschulbibliotheken gelistet ist. Mit dieser Arbeit ist mir die Situation auf diesem Gebiet so richtig bewusst geworden und so habe ich begonnen, das über die Jahre bei mir angesammelte Material aufzuarbeiten.
Und wie bist du auf die Idee mit der Website gekommen?

Hanna Rosemann und Volkmar Weitze, die Darsteller von Christine und Egon aus der Inszenierung Egon und das achte Weltwunder durch das Jugendtheater Radebeul 1967 bei einem Gastspiel an der Jugendhochschule Bogensee
Bild: Archiv Baum
Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Durch meine ehrenamtliche Arbeit im Landesverband war mir der Umgang mit derartigen Seiten natürlich vertraut. Also nicht von der technischen Seite her, mehr von der Sinnhaftigkeit und vom Inhalt. Das Technische besorgte ein mit allen atlantischen Wassern gewaschener IT-Spezialist. Der Dresdner Mike Bormann hatte in den USA studiert und betreute u. a. auch die Homepage des Verbandes. Daraus hatte sich eine freundschaftliche Beziehung entwickelt. Ihm habe ich die Website letztlich zu verdanken. Ohne Mike also kein Preis!
Du hast sicher eine große Menge an Material zu Hause. Wie muss man sich das vorstellen?
Nach dem ich 2013 meine Funktion im Verband niedergelegt hatte, habe ich mit der Sichtung und Systematisierung des Materials begonnen. Daraus hat sich dann langsam ein Archiv geformt, welches heute weit über 10.000 Artefakten enthält. Im Wesentlichen ist das sogenannte „Flachware“, bestehend aus Dokumenten, Programmheften, Plakaten, Abbildungen, Fotos, Beiträgen aus Printmedien aber auch Filmen. Dazu kommt noch die Bibliothek, die gegenwärtig über 800 Bände und Zeitschriften umfasst.
Das Material befindet sich größtenteils in meinem Arbeitszimmer. Der Rest musste leider an anderen Stellen gelagert werden. Zum Glück konnte ich Ende des vergangenen Jahres knapp 20 Ordner dem Deutschen Archiv der Theaterpädagogik an der Universität Osnabrück übergeben.
Osnabrück, liegt das nicht im Bundesland Niedersachen?
Ja, leider. Der theaterwissenschaftliche Bereich an der Universität Leipzig schien offensichtlich nicht interessiert. Seit 2017 stand ich mit dem dort neugegründeten CCT (Centre of Competence for Theatre) in Verbindung. Zu einer konkreten Vereinbarung ist es leider nicht gekommen, so dass ich mich Ende 2019 entschlossen habe, nach neuen Partnern zu suchen. Mit dem in Lingen ansässigen Archiv kam es dann sehr schnell zur Übergabe einer ersten Charge. Ehrlich gesagt bin ich froh, einen interessierten Partner gefunden zu haben, wo durch die Anbindung an den Studiengang Theaterpädagogik auch die Chance besteht, dass mit meinem Material wissenschaftlich gearbeitet wird. Genau darin sehe ich den Sinn meines Tuns.
Sammelst du das Material nur oder arbeitest du auch damit?
In der Hauptasche trage ich Materialien und Informationen zusammen. In der wissenschaftlichen Arbeit liegt sicher nicht meine Bestimmung. Der Mangel an wissenschaftlichen Arbeiten auf diesem Gebiet begründet sich gerade in einem Mangel an Quellenmaterial und der Unkenntnis über deren Lagerungsorte. Deshalb sehe ich neben dem Zusammentragen dieser Materialien meine Aufgabe auch in deren Aufbereitung. So habe ich beispielsweise eine Erfassung aller mir bekannten Inszenierungen des nichtprofessionellen Theaters von 1821 bis 1990 mit Quellenangaben erstellt. Auf meiner Website befinden sich sogenannte Zeittafeln, die Ereignisse rund um das nichtprofessionelle Theater von 1300 bis 1990 dokumentieren. Die Zeittafel 1944 bis 1990 enthält beispielsweise auch über 60 Eintragungen zu Radebeul. Hier kann der Nutzer ebenfalls auf die Quelle zurückgreifen. Für die Forschung ist das eine „wahre Fundgrube zur Geschichte des sächsischen Amateurtheaters“, wie die Jury des Sächsischen Heimatpreises einschätzte.
Einige kleine Aufsätze habe ich schon verfasst. Aktuell arbeite ich mit meinem Leipziger Freund Roland Friedel unsere Erinnerungen an die gemeinsame Zeit im Landesverband Amateurtheater Sachsen auf. Auch habe ich hin und wieder Studenten bei der Erstellung ihrer Abschlussarbeiten beraten.
Wir haben uns deine Website angesehen. Da sind ja tatsächlich eine Unmenge von interessanten Daten zu finden. Woher kommen die alle?
Der größte Teil stammt aus meinem Archiv. Natürlich führe ich auch ständig weitere Recherchen durch. Erst neulich bin ich auf zwei Theatergruppen in Cunewalde (Lausitzer Bergland) gestoßen, die nur etwa 20 Jahre existierten. Darüber hinaus halte ich auch Kontakte zu Kollegen und bin Sprecher des Bundesarbeitskreises „Geschichte, Kultur und Bildung“ im Dachverband „Bund Deutscher Amateurtheater“. Außerdem schreibe ich ja auch hin und wieder für Vorschau und Rückblick.
Die Redaktion dankt für das Interview und wünscht dir weiter viel Kraft für diese interessante Tätigkeit.