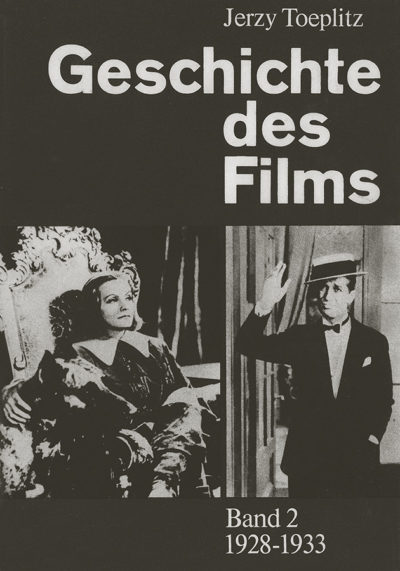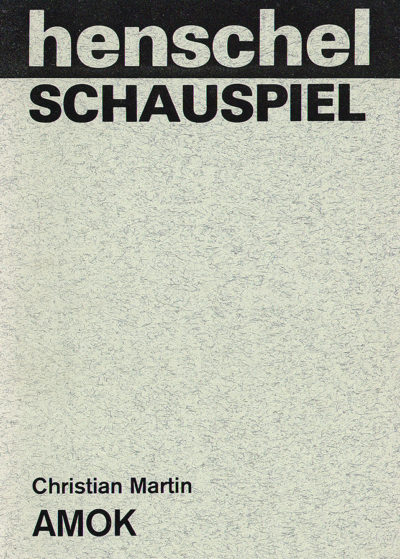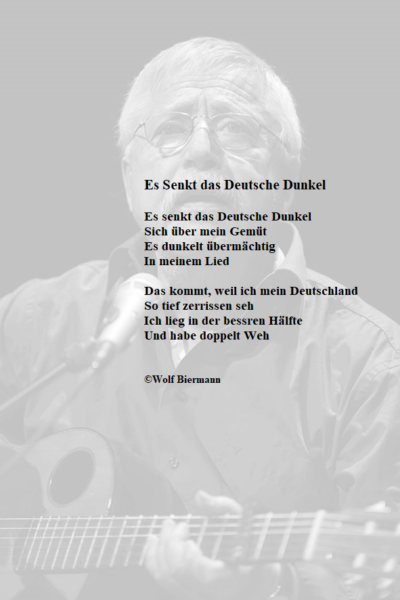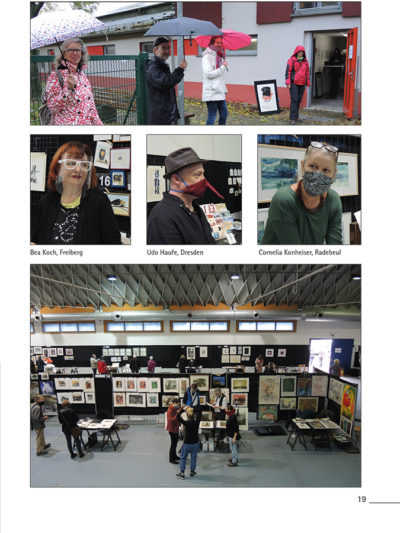Ein Tankwart lässt sich immer finden. Diesmal also sind es die Händler in Radebeul West und vermutlich die übergroße Mehrheit der 1.400 abgegebene Stimmen bei der Bürgerumfrage zum Verkehrskonzept um die Bahnhofstraße. Diese haben, so die Tatsachen, nicht für den Boulevard, aber für die Abschaffung der PKW-Stellplätze im mittleren Teil der Bahnhofstraße gestimmt. Ein SZ-Artikel hatte sie unlängst nochmals darauf hingewiesen und sie offensichtlich aus allen Wolken fallen lassen. Verdutzt rieben sich die Händler und Gewerbetreibende die Augen und meldeten schleunigst ihren Protest an.
Daraufhin rieben sich wiederum die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie die Stadträte die Augen und verstanden ihrerseits die Welt nicht mehr. Die Händler könnten nicht lesen, so der Vorwurf. Denn der Bürgerwille soll nicht verfälscht werden, meinten andere Stimmen. Abstimmung sei Abstimmung! Schließlich konnte sich ja jeder der wollte, so ein weiteres Argument, umfangreich informieren. In den Beiträge der Tagespresse, im Amtsblatt, der „Westpost“, auf der Internetseite der Stadt, ja auch im Aushang am ehemaligen Bürgertreff stand alles Schwarz auf Weis. Da kann man nun hinterher nicht kommen und etwas ganz anderes wollen! Richtig!
Trotzdem hat irgendetwas nicht funktioniert. Die Leute schienen nicht richtig verstanden zu haben, was beabsichtigt war. Wenn diejenigen, die es unmittelbar betrifft mit der angebotenen Lösung unzufrieden sind, kann doch etwas nicht stimmen. Was aber war hier bloß schiefgelaufen…?
Sind die Bürger zu träge, zu uninteressiert, gar des Lesen unkundig? Nun will ich ja nicht einfach den bundesdeutschen Durchschnitt des funktionalen Analphabetismus von etwa 14 Prozent (laut Wikipedia) auf die Radebeulerinnen und Radebeuler übertragen. Aber man fragt sich schon, woher so kurz vor der alles entscheidenden Beschlussfassung über die Planung zum Verkehrsraum der Bahnhofstraße durch den Radebeuler Stadtrat der plötzliche Unmut bei den Händlern und Gewerbetreibern dieses Gebietes aufgekommen ist. Am „nicht-lesen-können“ kann es jedenfalls nicht gelegen haben, denn der Beitrag in der „Sächsischen Zeitung“ wurde sofort verstanden.
Lag es vielleicht am Amtsdeutsch? Damit haben ja selbst gewiefte Advokaten so ihre Schwierigkeiten. Den geläufigen Ausspruch „ich höre Amtsdeutsch und verstehe nur Bahnhof“, kennt vermutlich jeder. Doch um den Bahnhof kann es nicht gegangen sein, der ist ja längst raus aus dem Spiel. Aber Scherz beiseite… Offensichtlich muss hier ein gravierendes Missverständnis vorgelegen haben. Nur so kann ich mir erklären, dass so viele für die Variante Null, gewissermaßen für Boulevard light, gestimmt haben und nicht gleich für einen Boulevard? Oder hatte es vielleicht an der Null gelegen…?
Die Null ist ja im philosophischen Sinne so etwas wie ein unbeschriebenes Blatt. Häufig klärt man ein nicht gelöstes Problem, indem man einfach nochmals „bei Null“ anfängt. Ich sage dann immer: Alles auf Anfang! War es das, was den Teilnehmern bei der Abstimmung über die drei Varianten der künftigen Verkehrsführung durch den Kopf gegangen ist?. Warum sonst wurde die erste Variante mit „Null“ beziffert, dachte auch ich? Der nicht näher erklärte Zusatz „optimierter Bestand“ auf der Abstimmungskarte enthielt zumindest mit dem Wort „Bestand“ die vermeintliche Bestätigung für diese Annahme, dass sich nichts ändern würde. Nun will ich ja der Stadt keine „Rosstäuscherei“ unterschieben. Aber den Wegfall der Stellplätze als „optimierten Bestand“ auszugeben, halte ich schon für einen üblen Trick, wie der durchaus berechtigte Aufschrei der Händler und Gewerbetreibenden deutlich machte. Denn jeder weiß, dass deren Umsätze in der Bahnhofstraße seit Jahren nicht so blendend aussehen, dass immer mal wieder der Eine oder Andere aufgeben muss und Läden leer stehen. Den Bürgern bei der Umfrage so ein Vorschlag unterzuschieben, der vortäuscht, dass alles bleibt wie es ist und dann doch nicht, ist schon ziemlich starker Tobak!
Aber so manchen Abgeordneten verstehe ich da auch nicht. Geht es nun darum, dass sich das betreffende Gebiet in Radebeul West zu einem funktionierenden Stadtteilzentrum entwickeln soll oder nicht? Da hilft es nicht, wenn man auf den „Tankwart“ einschlägt. Zumindest aber sehe ich am Horizont einen Hoffnungsschimmert: Auf Vorschalg der „Freien Wähler“ sollen die Betroffenen über die nun folgenden Maßnahmen Schritt für Schritt erneut befragt werden. Da werden sicher auch wieder die Stellplätze zur Diskussion stehen. Wann, das kann ich leider nicht vermelden, da diesmal der Redaktionsschluss schon sehr zeitig erfolgte. Auf alle Fälle aber wünsche ich allen Lesern ein schönes Fest und ein hoffentlich besseres 2021,
Euer Motzi.