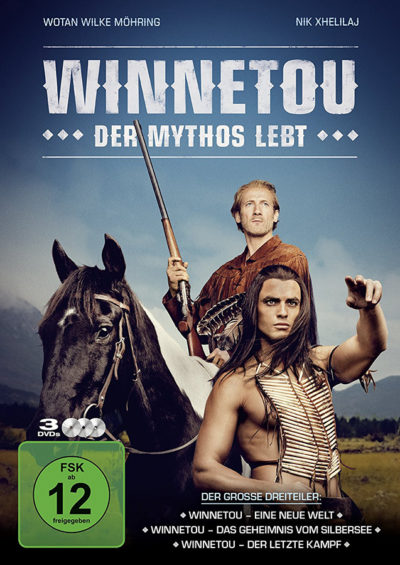Wenn man auf der Meißner Straße Richtung Coswig in die westlichste Ursprungsgemeinde Radebeuls einfährt, steht an der Einmündung der Coswiger Straße ein gediegen saniertes ehemaliges Bauernhaus. An der Straßenfassade mit der wohl proportionierten Fensterteilung und den Fensterläden steht „Restaurant & Pension Charlotte K.“
Immer, wenn ich dort vorbei fuhr, bewunderte ich in Gedanken Ines Kuka, an dieser (vom Autofahrer gefühlten) vom Verkehr geprägten Stelle, ein Gourmet -Restaurant zu betreiben. Zu ganz besonderen Anlässen sind wir auch eingekehrt – wahrscheinlich zu wenig, denn im Sommer war zu hören, dass Ines Kuka ihren Traum aufgeben musste. Nun stellte sich die Frage, wie es weitergehen würde.
Der Auslöser das Haus zu sanieren, war ursprünglich ein anderer. Dr. Bernd Kastler, der auf dem von Carl Pfeiffer angelegten Wächterberg Weinbau betreibt, hatte den Enthusiasmus seinen geernteten Wein selbst auszubauen und suchte dafür einen Keller, den er hier fand.
Hier für den interessierten Leser ein kurzer Abriss zu Vergangenheit und Gegenwart dieses Unterfangens:
„J.G.T. – 1827“ steht auf dem Türsturz der Eingangstür zum Weinrestaurant Charlotte in der Coswiger Straße 23. Das weist auf das Baujahr des Gebäudes und den damaligen Bauherrn Johann Gottlieb Trobisch hin. Es wurde als Teil eines Zweiseitenhofs auf den Resten eines vermutlich bereits aus dem 18. Jahrhundert stammenden und einem Brand zum Opfer gefallenen Gebäudes errichtet. Das Tonnengewölbe im Keller dürfte deutlich vor 1827 entstanden sein.
Viele Jahrzehnte diente das Gebäude als Gärtner- und Winzerhaus. Der den Lesern von V&R gut bekannte Winzer Rainer Rossberg verbrachte hier seine Jugend. Im Jahr 2004 übernahm die Familie Kastler das Grundstück und sanierte das denkmalgeschützte Gebäude grundlegend. Die nach dem Urteil der Jury gelungene Sanierung wurde 2008 mit dem Bauherrenpreis der Stadt Radebeul ausgezeichnet. Ein Jahr später folgte ein Erster Preis beim Sächsischen Landeswettbewerb für Ländliches Bauen.
Heute beherbergt das Grundstück das Weinrestaurant Charlotte und den Weinbau von Bernd Kastler und Enrico Friedland, die seit 2013 ihre Weine gemeinsam herstellen und dem Weinfreund zum Kauf anbieten. Selbstverständlich werden ihre Weine im Restaurant angeboten. Wer will, der kann hier auch eine oder mehrere Flaschen zu Ab-Hof-Preisen erwerben.
Im Herbst werden im Nebenhaus die Trauben gepresst. Anschließend wird der Traubenmost im Keller vergoren – in Edelstahltanks, aber auch immer häufiger in Eichenholzfässern. Danach haben die Weine ihre verdiente Winterruhe, wobei das Tonnengewölbe vor großen Temperaturschwankungen schützt.
„Elbtalweine für Entdecker“ lautet das Motto des Weinguts. Bernd Kastler und Enrico Friedland haben Weinberge in den Radebeuler Einzellagen Goldener Wagen, Steinrücken und Johannisberg. Im Rebsorten-Angebot sind sächsische Klassiker wie Riesling, Weißburgunder, Traminer und Müller-Thurgau. Ein besonderes Augenmerk legen die Winzer auf nicht so häufig vertretene Sorten wie Kerner, Scheurebe, Bacchus und Silvaner. Dem Vernehmen nach sollen demnächst auch Rotweine die Palette erweitern.
Das Weingut hat im bekannten Weinführer Gault & Millau erstmals eine Traube erhalten. Der Weinführer lobt in Bezug auf den Jahrgang 2015 die feine Rebsortenaromatik und den mineralischen Schliff, besonders die rassige Art der Scheurebe und des Rieslings. Ein Sonderlob erhält auch der teilweise im Holzfass gereifte Weißburgunder, der darüber hinaus auch eine Goldmedaille vom internationalen Weinwettbewerb AWC Vienna nach Sachsen bringen konnte.
Das alles ist für Kastler und Friedland ein zusätzlicher Ansporn, um die Gläser der Weinfreunde auch in Zukunft mit ausgezeichneten Weinen zu füllen.
Man ist mit dem Auto zu schnell vorbei, um einen angemessenen Blick auf das Gebäude zu werfen und ein Schritt in den Hof zum Weinbauern gelingt spontan so auch nicht. Hier kann ich nur empfehlen, mal wieder zu Fuß dorthin zu gehen. Parkmöglichkeiten findet man gut in der Nähe. Und wenn man dann dort so steht und nicht nur den Blick für den kleinen Stau an der Ampel an der Gerhart – Hauptmann – Straße hat, entdeckt man, dass das Restaurant wieder geöffnet hat.
Als Weinrestaurant „Charlotte“ hat es am 05.11.2016 wieder seine Türen für alle, die Genuss und guten Wein lieben, geöffnet. Mit dem Konzept eines Weinrestaurants, das sich vor allem auf die Zusammenarbeit mit dem Weingut Kastler-Friedland stützt, sollen Stammgäste und neues Publikum angelockt werden.
Geschäftsführer Udo W. Schulze konnte als Küchenchef den in der Szene bekannten Tilo Hamann, der sich seine Sporen im Gasthof Eulowitz verdiente und zuletzt im Schlosshotel Pillnitz kochte, gewinnen. Als Euro-Toques Chef und deren Landesbeauftragter in Sachsen verspricht Hamann seinen Gästen besondere Gaumenerlebnisse mit regionaler und internationaler Küche. Für den Service verantwortlich ist Herr Jörg Meier, der eine fundierte Ausbildung als Sommelier hat und mehrjährige Erfahrungen in Restaurants im In- und Ausland gesammelt hat. Mit diesen Personalien will Schulze das Weinrestaurant „Charlotte“ auch weiterhin als Feinschmeckerrestaurant führen.
Das Konzept des Weinrestaurants soll auf 6 festen Füßen stehen. Es umfasst – natürlich – die Bewirtung der Gäste im à la carte-Geschäft von Freitag bis Sonntag; den neu eingeführten Table d’hôte, der ein 3-Gang-Menü, serviert an jedem Donnerstag an der großen Tafel, bezeichnet, zu der sich jeder Gast hinzugesellen kann; die Ausrichtung von Familien- und Firmenfeiern; Kochkurse und Kochevents, vorrangig an den Wochenenden; die Vermietung von zwei attraktiven Fremdenzimmern an müde Gäste; sowie interessante Veranstaltungen und Ausstellungen.
Und dass dieses Konzept mit Leben erfüllt wird, beweist die gerade erfolgte Eröffnung der Ausstellung „Regina Baum – Innen bunt“, zu deren Vernissage sich mehr als 50 interessierte Gäste einfanden.
Auch Lesungen gehören zum kulturellen Angebot. Am 19. Februar war die Sächsische Literaturpreisträgerin 2016, Franziska Gerstenberg, die aus ihrem aktuellen Erzählband „So lange her, schon gar nicht mehr wahr“ gelesen hat, zu Gast und am 19. März um 19 Uhr wird Stephan Ludwig, der Krimiautor aus Halle/S. mit seinem neuesten Zorn-Krimi „Wie du mir“ in Radebeul sein.
Weitere Ausstellungen und Lesungen sind bereits in Planung.
Guten Zuspruchs erfreuen sich auch die Veranstaltungen aus der Reihe „Topfgucker“. Tilo Hamannn bietet immer am Sonntag thematische Kochkurse für 4-6 Personen an. Zwischen 10 Uhr (bzw. 11 Uhr) und 14 Uhr können die Kocheleven die Geheimnisse einer guten Küche entdecken und anschließend gemeinsam das Produkt des Vormittags verzehren. Dazu können dann weitere Angehörige oder Freunde eingeladen werden.
Noch nicht ganz so bekannt ist der Table d’hôte. Diese aus Frankreich stammende Idee ist eigentlich ganz simpel: An einer eingedeckten Tafel finden sich die Gäste ein, um gemeinsam ein vom Küchenchef festgelegtes Menü zu genießen. Man lernt sich kennen, kommt miteinander ins Gespräch und wird einen angeregten Abend verleben. Immer am Donnerstag wird dazu eingeladen.
Ein unvergesslicher Abend, ein tolles Erlebnis, eine gelungene Veranstaltung – das Team des Weinrestaurants „Charlotte“ freut sich darauf, das alles für seine Gäste gestalten zu dürfen.
Es tut sich ganz schön viel in der Charlotte! Und wenn Sie einmal aus dem Auto ausgestiegen oder per Straßenbahn angereist sind, dann gibt es ergänzend zu der Idee, „gut Essen zu gehen“ noch viel Schönes in der Nähe zu sehen, wo (nur) die Füße hintragen können. Wenige Schritte benötigt man bis zum etwas im Verborgenen liegenden hübschen und beschaulichen Dorfkern von Alt-Zitzschewig. Von den Hängen grüßen Hohenhaus und das Gebäude des Zechsteins, wo liebevoll ein Weinlehrpfad angelegt ist. Überall hin führen Wege mit schönen Aussichten und bei einer Runde um den Naundorfer Dorfteich erlebt man immer wieder die Freude, eine in ihrer Kleinteiligkeit und Unverwechselbarkeit so schöne Heimatstadt zu haben. Vielleicht regt Sie der Artikel an, dem an dieser Stelle Radebeuls so vielseitig zu entdeckenden Genuss nachzuspüren.
Michael Mitzschke mit Unterstützung von Dr. Bernd Kastler und Dr. Jens Ola