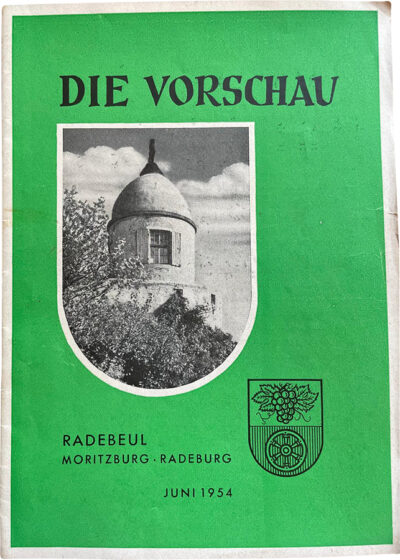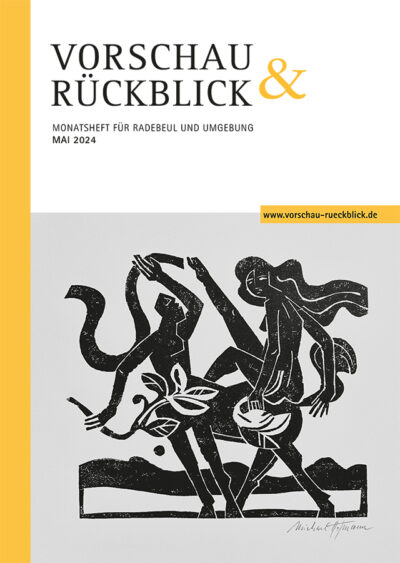Oder: Lebhafte Leserdiskussion erwünscht!
Bei der Frage, ob Radebeul eine Kulturentwicklungskonzeption braucht, scheiden sich die Geister. Die einen winken gleich ab und meinen: Die wandert doch sowieso in die Schublade. Schließlich hatte kaum einer mitbekommen, dass ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (2014: INSEK 2) existiert. Doch da sind auch noch die anderen, die Interessierten, die meinen, dass so Manches nicht in die Hose gegangen wäre, wenn es eine langfristige, im öffentlichen Bewusstsein verankerte Planung gegeben hätte. Nun sollen nicht gleich am Anfang dieses Beitrages die Radebeuler Stimmungskiller Erwähnung finden, wie der bedenkliche Zustand des Bahnhofs in Radebeul-West oder die lange Liste von opulenten Gebäuden, die nach 1990 dem Abriss zum Opfer fielen. Also: Schnitt! Was weg ist, ist weg, da hilft auch kein Gejammer mehr!
Viel sinnvoller ist es doch, man geht die ganze Sache von der positiven Seite an. „Radebeul bekennt sich zur Erhaltung seiner kulturellen Vielfalt“ – zumindest wurde das bereits mehrfach und mit Nachdruck postuliert. Na, wer sagts denn, das ist doch schon ein guter Anfang!
Die Leser seien in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass das INSEK 2 in verknappter Form wichtige Aussagen, Ziele und Handlungshinweise zur Kulturentwicklung von Radebeul enthält. Das umfangreiche Kompendium mal wieder in die Hand zu nehmen, lohnt sich durchaus. Spannend ist: Was wurde im Verlaufe von zehn Jahren umgesetzt? Was wartet noch heute auf seine Realisierung? Was wurde wieder verworfen? Was kam zwischendurch an Neuem hinzu?
Einige Gedanken zur Kultur in Radebeul wurden bereits vom scheidenden Bildungs- und Kulturamtsleiter Dr. Dieter Schubert (1940–2012) im Jahr 2005 fixiert und war mit der Empfehlung verbunden, dass eine Konzeption erforderlich sei. Danach trat eine längere Pause ein. Schließlich stellte die Fraktion der Freien Wähler im März 2017 den Antrag, die Stadtverwaltung damit zu beauftragen, eine Kulturentwicklungskonzeption für die Große Kreisstadt Radebeul zu erarbeiten. Im Juni 2018 einigte man sich im BKSA (Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss) auf die Bildung von Facharbeitsgruppen mit konkreten namentlichen Vorschlägen. Doch nun ging es Schlag auf Schlag – aber in die falsche Richtung. Was folgte waren ein rasanter Generationswechsel, strukturelle Veränderungen, personelle Umbesetzungen sowie die alles in Frage stellende Corona-Pandemie.

Jan Dietl und Uwe Wittig vom Theater Heiterer Blick in »Nosferatu«, Aufführung in der unsanierten Mittelhalle des Bahnhofs Radebeul-Ost, 2010
Im April 2023 wurde erneut Anlauf genommen und die Fraktion der Freien Wähler erinnerte an die ausstehende Kulturkonzeption. Endlich begann man in rasantem Tempo Nägel mit Köpfen zu machen. Unter Federführung der Kulturamtsleiterin Dr. Gabriele Lorenz fanden von Oktober 2023 bis Januar 2024 im Kulturbahnhof fünf themenorientierte Kulturforen statt. Parallel wurden zu unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen Arbeitsgruppen in neuer Personenkonstellation gebildet. Der erste Entwurf stand alsbald im BKSA zu Diskussion und wurde danach mit einigen Ergänzungen zur Beschlussfassung an den Stadtrat weitergeleitet. Das Ganze erfolgte „kurz vor knapp“, denn schon wieder geht eine Legislaturperiode zu Ende. Sollte die Kulturkonzeption also zur letzten Sitzung des alten Stadtrates im Juni 2024 beschlossen werden, wäre eine wichtige Hürde genommen. Nichts ist in Stein gemeiselt und alles kann immer wieder den aktuellen Bedingungen angepasst werden.
Sich als Radebeuler Bürger mit dieser Konzeption auseinanderzusetzen, lohnt sich schon deshalb, weil sie mehr oder weniger die Lebensqualität aller betrifft und weil sie für einen langen Zeitraum, genauer gesagt bis 2030, ausgelegt ist. Der Inhalt einer solchen Konzeption ist sehr komplex. Bereits im Integrierten Stadtentwicklungskonzept wurden Themen wie Bildende, Darstellende und Angewandte Kunst, Heimat- und Traditionspflege, Erinnerungs-, Medien-, Sozio-, Jugend-, Fest- und Weinkultur berührt. Beigefügt war eine Auflistung aller kulturellen Einrichtungen wie Museen, Galerien, Theater, Bibliotheken, Ateliers, Werkstätten, temporär offene Häuser, Spezialschulen, soziokulturelle Zentren, Archive und Sammlungen sowie aller kulturorientierten Vereine, Gruppen und Initiativen. Doch seitdem hat sich vieles verändert, denn die Kulturszene ist in ständiger Bewegung.
Einen roten Faden zu finden, ist für Zugezogene sicher nicht leicht. Da sind die Neubürgerempfänge im Stammhaus der Landesbühnen doch eine sehr gute Idee. Selbst alteingesessenen Radebeulern fällt es mitunter recht schwer, das aktuelle Kulturgeschehen in der Lößnitzstadt zu überschauen. Wenn boshafte Menschen behaupten, dass Radebeul eine Schlafstadt sei, entspricht das nicht der Realität. Die Fülle der Kultur- und Freizeitangebote ist erstaunlich. Doch das alles wäre nicht möglich ohne jene engagierten Vereine und Bürger, die Radebeul das ganze Jahr über als Stadt voller kreativer Energie und Lebensfreude zeigen.
„Kultur muss man sich leisten können“, ist wohl einer der blödesten Sprüche, der einem immer wieder zu Ohren kommt. Dabei ist das Bedürfnis nach Geselligkeit, kultureller Selbstbetätigung und Bildung im weitesten Sinne doch keine anmaßende Erfindung der Gegenwart. Bereits 1842 wurde in der Niederlößnitzer Schule die erste Jugend- und Gemeindebibliothek eingerichtet. Im Jahr 1844 gründeten in Kötzschenbroda 21 sangesfreudige Gewerbetreibende den Männergesangverein „Liederkranz“. Über das Auf und Ab des stark ausgeprägten Vereinslebens in den Lößnitzortschaften zu schreiben, wäre ein spannendes Kapitel für sich.
Das Bekenntnis von Politik und Verwaltung zum Erhalt der kulturellen Vielfalt ist nicht nur ein Bekenntnis zu den städtischen, sondern vor allem auch zu den nichtstädtischen Kultureinrichtungen wie den Landesbühnen Sachsen, dem Karl-May-Museum, dem Sächsischen Weinbaumuseum Hoflößnitz, der Musikschule und der Traditionsbahn, welchen durch die Dynamisierung der jährlichen Zuschüsse eine sichere Basis geboten wird. Sowohl für die großen Einrichtungen als auch die vielen kleinen Initiativen gilt es, belastbarer Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Kultur stattfinden kann und die Akteure eine sinnvolle Unterstützung erfahren. Eine Sonderstellung nimmt Radebeul mit seinen über 60 ortsansässigen Bildenden Künstlern ein. Hinzu kommen zahlreiche freischaffende Einzelkünstler und Künstlergruppen verschiedenster Sparten. Dieser Tatsache sollte auch die Kulturentwicklungskonzeption Rechnung tragen. Mit Unterstützung ist nicht nur die Ausreichung von Fördermitteln gemeint, sondern auch eine zielgerichtete Koordination, Vernetzung und Terminabstimmung. Ebenso wäre eine zentrale Plattform zur Vermittlung von Wohn-, Arbeits-, Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen sehr hilfreich.
Allerdings findet Kultur nicht im luftleeren Raum statt. Die Bevölkerungsentwicklung, das Freizeitverhalten und das Fortschreiten der Digitalisierung spielen keine unwesentliche Rolle. Auch die stimulierende Wirkung einer sozial, kulturell und politisch offenen Atmosphäre ist nicht zu unterschätzen. Vieles war nach 1989 möglich. Neue Veranstaltungsreihen wurden in städtischer Regie etabliert wie das Herbst- und Weinfest (1991), die Karl-May-Festtage (1992) und das Wandertheaterfestival (1996). Bereits vor 1990 eingeführte Veranstaltungsreihen wie der Grafikmarkt (1979) und die Kasperiade (1987) wurden ab 1990 bzw. ab 2004 in städtische Regie übernommen. Allerdings war das u. a. auch der Fantasie, Weitsicht und Überzeugungskraft einzelner leidenschaftlicher Kulturakteure zu verdanken. Überlegungen diese kulturellen Großveranstaltungen zu privatisieren oder an Vereine zu übertragen, wurden verworfen. Das Bekenntnis zum Erhalt der kulturellen Vielfalt war über all die Jahre nicht nur ein Lippenbekenntnis. Die Frage, weshalb sich Radebeul ein Kulturamt „leistet“, beantwortet sich eigentlich von selbst.
In der gegenwärtigen kulturellen Praxis wird der öffentliche Stadtraum viel stärker in die Veranstaltungsplanung einbezogen. Neben der traditionellen Festwiese in Radebeul-West sind nun die Kultur-Terrassen in Radebeul-Ost ein häufig genutzter Veranstaltungsort, so wie auch die innerstädtischen Zentrumsbereiche und die Dorfkerne der Ursprungsgemeinden. Neue Open-Air-Veranstaltungsreihen wie „WeinbergKulTour“, „Fête de la Musique“ und „Kunst geht in Gärten“ konnten sich erfolgreich behaupten.
Radebeul schillert viel zu lebendig, als dass es sich in ein Schema pressen ließe. Bezeichnungen wie „Karl-May-Stadt“ oder „Wein- und Gartenstadt“ greifen hier zu kurz. Überregional bekannte Persönlichkeiten wurden nach 1990 wiederentdeckt. Das Wirken des Generalmusikdirektors Ernst Edler von Schuch, des Naturheilkundlers Friedrich Eduard Bilz, der Zirkusfamilie Sarrasani und der Baumeisterfamilie Ziller wird nach und nach aufgearbeitet und öffentlichkeitswirksam herausgestellt. Auch reift die Erkenntnis, das Radebeul nicht nur zu den nördlichsten Weinanbaugebieten gehört, sondern auch ein bedeutender Industriestandort war und ist.
Während die kulturelle Szene in Radebeul erfreulich pulsiert, schreitet der Verfall des historischen Bahnhofsgebäudes in Radebeul-West unerbittlich voran. Und schon bald werden mehr oder weniger melodische Klänge aus der gegenüberliegenden Musikschule den Prozess des Vergehens begleiten. Die Natur holt sich beharrlich den einstigen Bürgerstolz zurück. Dass für die Große Kreisstadt Radebeul nun endlich eine Kulturentwicklungskonzeption auf den Weg gebracht wurde, kommt für den Bahnhof vermutlich zu spät. Ob die Konzeption in einer Schublade verstaubt, liegt auch an jedem von uns selbst. Die stattgefundenen Kulturforen jedenfalls sollten auf mehrfach geäußertem Wunsch unbedingt eine Fortsetzung erfahren.
Karin (Gerhardt) Baum