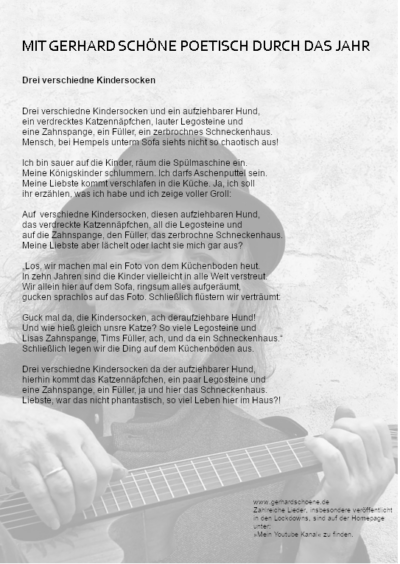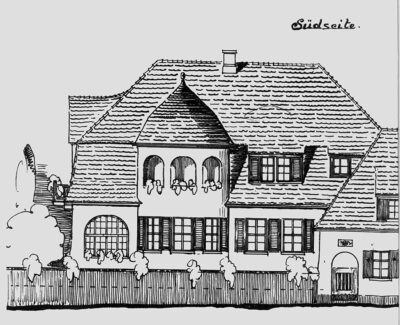am 17. November 2022, um 19.30 Uhr
im Alchimistenkeller der Alten Apotheke, Altkötzschenbroda 48
Der fünfte thematische Filmabend des FilmClubMobil erfolgt in Kooperation mit der Kultur- und Werbegilde Kötzschenbroda. Zu Gast ist der Radebeuler Volkschauspieler und Kunstpreisträger Herbert Graedtke. Viele Weinfestbesucher werden sich an ihn als lebenslustigen Bacchus erinnern. In den Landesbühnen Sachsen hat er unzählige Rolle gespielt. Aber auch in zahlreichen Filmen wirkte er mit. Am Anfang seiner Filmografie stand 1961 die Komödie „Auf der Sonnenseite“. Im Kriminalfilm „Die Glatzkopfbande“, seinem dritten Film, spielte er das Bandenmitglied „Warze“. Von den damaligen Dreharbeiten wird er zur Einstimmung auf den Film einige Anekdoten zum Besten geben.
Der Filmregisseur und Drehbuchautor Richard Groschopp (1906-1996) hatte eine Konditorlehre absolviert und arbeitete danach auch in diesem Beruf. In der Freizeit beschäftigte er sich mit dem Thema Film und erhielt schon bald erste Auszeichnungen für seine Kurzfilme und das Angebot hauptberuflich als Kameramann und Regisseur zu arbeiten. Ab 1946 war er bei der neu gegründeten DEFA in Sachsen tätig und wechselte später ins DEFA-Studio für Spielfilme nach Potsdam-Babelsberg. Zu den bekannten seiner DEFA-Filme zählen u. a. 1961 „Die Liebe und der Co-Pilot“, 1962 „Die Glatzkopfbande“ oder1967 „Chingachgook, die große Schlange“.
Die Glatzkopfbande
DEFA-Film, 1962/63, 74 Min., Regie: Richard Groschopp, Drehbuch: Lothar Kreutz, Richard Groschopp
Es sind nur wenige Tage, bevor sich am 13. August 1961 in Berlin die „Mauer“ schließt. Noch ahnt niemand etwas davon. Plötzlich stürzt auf einer Baustelle ein Neubau zusammen, zwei Menschen kommen dabei ums Leben. Es wird festgestellt, dass „Schluderarbeit“ das Unglück verursacht hat. Einer der Übeltäter ist ein Gastarbeiter aus Westberlin, welcher nun gesucht wird. Der ehemalige Fremdenlegionär hatte inzwischen eine Gruppe junger Männer um sich geschart, die seit Wochen am Ostseestrand ihr Unwesen treiben. Ihren Bandenführer nennen sie „King“ und geben sich selbst recht seltsame Spitznamen. Wie der amerikanische Kinoheld, Yul Brunner, haben sie sich Glatzen scheren lassen, tanzen Rock ’n‘ Roll, singen Westschlager und drehen ihre „Kofferheulen“ auf. Die Situation beginnt zu eskalieren. Ihre Aktionen werden immer brutaler. Als King in den Westen fliehen will, wird er gestellt. Die Staatsmacht bringt ihn und seine ruchlosen Kumpane zur Strecke.
Der 1963 uraufgeführte Film „Die Glatzkopfbande“ basiert teilweise auf realen Begebenheiten. Er war ursprünglich als eine nachträgliche Legitimation des Mauerbaus gedacht und sollte die schädlichen Einflüsse des Westens aufzeigen. Doch der gewünschte erzieherische Effekt schlug fehl und animierte so manchen Jugendlichen wohl eher zur Nachahmung. Der Film löste heftige Kontroversen aus und wurde trotz guter Publikumsresonanz (rund 2,2 Millionen Besucher in fünf Jahren) schließlich aus den Filmtheatern verbannt.
Unmittelbar nach dem Hauptfilm „Revolte am Ostseestrand“, ein Dokumentarfilm von Inge Bennewitz und Jürgen Ast aus dem Jahr 2001 über „Die wahre Geschichte der Glatzkopfbande“, 45 Min. mit freundlicher Unterstützung durch die Bundesstiftung Aufarbeitung
Reservierungen unter: 0160-1038663
Karin Baum und Michael Heuser
Sprecher der Cineastengruppe „Film Club Mobil“ im Radebeuler Kultur e.V.