Allen Freunden der Lößnitz und ihres Künders Paul Wilhelm ist die facettenreiche Ausstellung einer gelungenen Auswahl seiner Werke in der Stadtgalerie Radebeul 2011 noch in guter Erinnerung.
Nun wurde auch oberhalb der Meißner Straße seiner gedacht und an den 50. Todestag am 23. Oktober 1965 erinnert. In der neu in die Welt getretenen „AUSSTELLUNG DRESDNER KUNST“ wird eine umfängliche Auswahl von Aquarellen an Paul Wilhelm in privaten Räumen auf der Hohen Straße 35 präsentiert.
Seit Werner Schmidts großer Aquarell-Ausstellung aus Anlass des 80. Geburtstages von Paul Wilhelm im Jahre 1966, hat es keinen solchen Blick auf sein Aquarellwerk mehr gegeben. So ist auch vor dem Hintergrund inzwischen eingetretener Kunstentwicklungen der Versuch wichtig, dass auch hier in Radebeul für die Ausprägung der Dresdner Malkultur von Paul Wilhelm Geleistete für eine breitere Öffentlichkeit wieder vernehmbarer ins Gedächtnis zu rufen. Dies auch deshalb, weil von den öffentlichen Museen kaum derartige Impulse ausgehen.
Zunächst noch in der Zeit des ersten Weltkrieges dem große Paul Cézanne verpflichtet, nehmen die Aquarelle, „das Werk der guten Stunde“ (Fritz Löffler) seit Mitte der 20er Jahre auch im Ergebnis seiner Reisen einen zunehmend breiteren Raum im Werk Paul Wilhelms ein. Nach dem zweiten Weltkrieg gewinnen die Aquarelle den Status einer eigenständigen Werkgruppe, die, unabhängig von der Ölmalerei, eigene Geltung beansprucht. Sie sind es auch, die noch einmal beredtes Ausdrucksmittel in seinen letzten Lebensjahren werden, in denen die Anstrengungen der Ölmalerei nicht mehr zu bewältigen sind.
Das Aquarell muss „sitzen“, da ist nachträglich nichts zu beschönigen oder zu korrigieren.
Daher begegnet uns Paul Wilhelm hier daher mit Komposition, Tektonik und Weltsicht, vor allem aber in seiner sublimen Farbsetzung ganz unmittelbar und persönlich. Es sind die Eindrücke des italienischen Lichts südlich der Alpen, die seine expressiven Blätter aus den frühen 20er Jahren bestimmen und denen in der Ausstellung ein eigener Raum gewidmet ist.
Ihnen stehen die flammenden Himmel der Lößnitz mit ihrem Orange und Tief-Violett in nichts nach, wie die Ausstellung ebenfalls nachweist. In der Schilderung seines Gartens und dessen Blumenpracht zwischen Rittersporn, Phlox und chinesischer Wildrose erweist sich das Aquarell in seinen besten Arbeiten als ein Gegenüber äußersten künstlerischen Anspruchs.
Weniger bekannt sind der breiteren Öffentlichkeit bisher die Porträts von Jungen und Mädchen oder jungen Frauen. In der Ausstellung ist diesem Aspekt des Wirkens von Paul Wilhelm breiterer Raum gegeben.
In seinen letzten Lebensjahren fand die lebenslange Zuneigung Paul Wilhelms zur kontemplativen Kunst Japans und seiner meisterlichen Farbholzschnitte, Ausdruck in seinen Aquarellen auf feinstem Japanpapier, die klassische japanische Holzschnitte zitieren. Die besondere Papiertextur reizte ihn auch zu Erinnerungsbildern früherer Reisen, vielfach auf der Basis von Gedächtnisprotokollen in Form von feinen Graphitzeichnungen. Paul Wilhelms späte Aquarellkunst erreicht mit sparsamen graphischen Zeichen ein Höchstmaß an künstlerischer Konzentration, ausgewogener Komposition der Darstellung in der farblichen Realisierung.
Die Ausstellung zum 50. Todestag Paul Wilhelms vereint Arbeiten des Künstlers, die über einen Zeitraum von ca. 50 Lebensjahren entstanden sind. Sie geben Zeugnis von seiner Zeichenkunst ebenso wie von seinem treffsicheren, musikalischen Farbgespür, das auch heikelste Farbkombinationen (z. B. in den Stillleben) sicher meistert.
Paul Wilhelms Aquarelle verführen und wecken in einer glücklichen Stunde in uns die Kräfte einer poetischeren Weltsicht, der sich zu überlassen alle Besucher herzlich eingeladen sind.
Gottfried Klitzsch
Ausstellungsort:
AUSSTELLUNG DRESDNER KUNST
Hohe Straße 35
01445 Radebeul-West
Öffnungszeiten:
07. November bis 19. Dezember 2015
01. Januar bis 28. Februar 2016
jeweils samstags von 11.00 bis 18.00 Uhr

![9-paul-wilhelm2[1]](http://www.vorschau-rueckblick.de/wp-content/uploads/2015/12/9-paul-wilhelm21-400x287.jpg)
![9-paul-wilhelm1[1]](http://www.vorschau-rueckblick.de/wp-content/uploads/2015/12/9-paul-wilhelm11-400x287.jpg)
![geburtstag-sax[1]](http://www.vorschau-rueckblick.de/wp-content/uploads/2015/12/geburtstag-sax1-207x600.jpg)

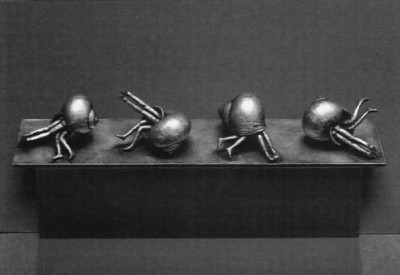

![5-Joachim-richter[1]](http://www.vorschau-rueckblick.de/wp-content/uploads/2015/12/5-Joachim-richter1-400x437.jpg)



