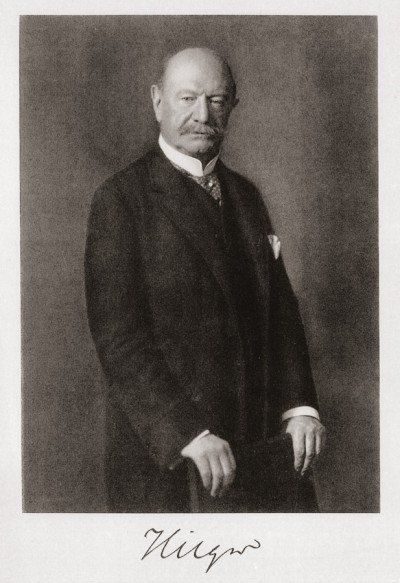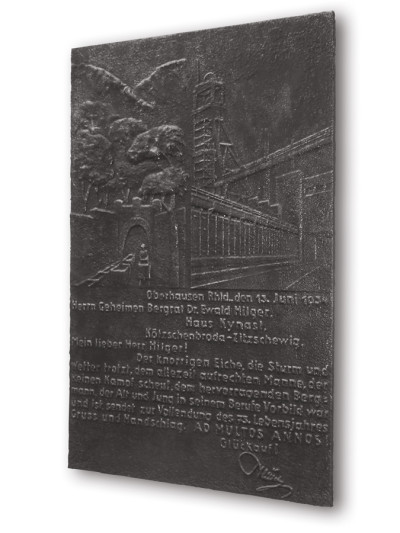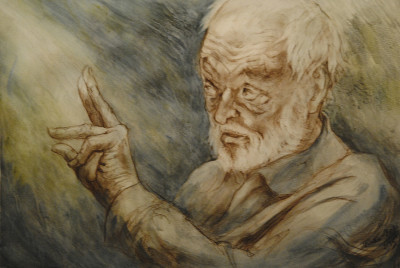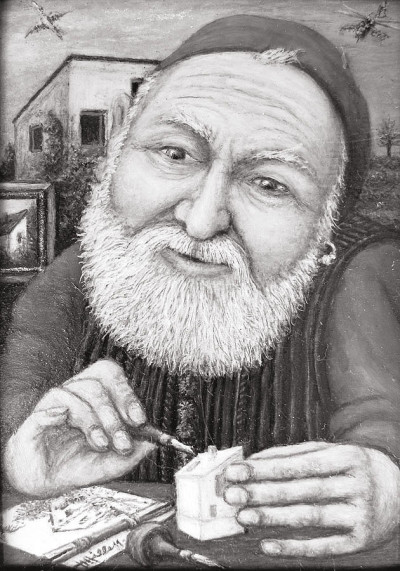Guiseppe Verdis ergreifende Oper „Don Carlo“ feierte an den Landesbühnen Sachsen Premiere
Achtundzwanzig Jahre nach seinem Debüt mit der Oper „Oberto“ (1839) komponierte Guiseppe Verdi 1867 die Musik zu seiner nunmehr 16. Oper. Unter dem Titel „Don Carlo“ fand die damalige Uraufführung in Paris statt. Wann immer „Don Carlo“ in den darauffolgenden Jahrzehnten bis in unsere Gegenwart hinein eine Neuinszenierung erlebte, so fand sie an bedeutenden Opernhäusern und in großen Städten statt. So gesehen wäre die Dresdner Semperoper wohl der bestens geeignete Ort für eine Dresdner Neuinszenierung jenes „Don Carlo“ gewesen. Doch diese neue Annäherung an Verdis gehaltvolle Oper machte um das dominante Dresdner Opernhaus einen Bogen und begab sich stattdessen unter die Fittiche des Musiktheater-Ensembles der Landesbühnen Sachsen, die „Don Carlo“ in Radebeul auf die Bühne brachten. Für das gesamte Ensemble wie auch für das Regieteam wuchs sich dieser Abend zu einem wunderbaren, großartigen Fest aus. Schon lange hatte eine Inszenierung der Musiktheatersparte keinen solch überwältigenden Erfolg feiern können, wie er an diesem 16. Januar gelang. Mit Standing Ovations in üppiger Menge feierte das Radebeuler Publikum das Ensemble und die Macher gleichermaßen. Zweifellos waren diese Lorbeeren auch ordentlich verdient. Der erfahrende Regisseur Michael Heinicke bediente ausgesprochen schlüssig die aufregende Story um die Liebe zwischen Elisabeth von Valois (Stephanie Krone) und den spanischen Infanten Don Carlo (Christian Salvatore Malchow). Doch diese Liebe ist nicht von Dauer; da Don Carlos Vater Philipp II. selbst ein Auge auf Elisabeth geworfen hat. Sämtliche Vermittlungsversuche von Gönnern und Freunden Don Carlos schlagen fehl. Ja mehr noch; Prinzessin Eboli (Wiebke Damboldt) lädt Don Carlo zu einem Rendezvous. Er aber glaubt, die Einladung komme von Elisabeth die Valois, denn der Brief ist mit „E.“ unterzeichnet. Als die Eboli entdeckt, dass Carlos gar nicht in sie, sondern in die Königin verliebt ist, schwört sie Rache. So endet eine, aus Irrungen und Wirrungen entstandene Beziehungsgeschichte tragisch, obwohl eigentlich die Momente der Harmonie überwiegen. Don Carlos Stoßseufzer am Ende lautet „Sie hat mich nie geliebt!“ und die Situation wird damit zur Tragik pur.
Neben den großartigen, sowohl gesanglichen als auch darstellerischen Leistungen der Solisten überzeugt ganz besonders auch der Chor. Das wird aber nicht nur von dessen stimmlicher Kraft gespeist, sondern lebt vor allem auch von der grandiosen Idee, den Chor der Landesbühnen Sachsen mit Mitgliedern des freien Opernchores „ChorusSo“ aufzufüllen. Die dadurch entstandene stimmliche und musikalische Kraft gehört im Ergebnis mit zu den eindrucksvollsten Momenten dieser Inszenierung.
Wolfgang Zimmermann
Nächste Aufführungen:
- 25.3., um 20 Uhr an den LaBüSa
- 22.4., um 19.30 Uhr am König Albert Theater in Bad Elster
- 24.4., um 15 Uhr an den LaBüSa