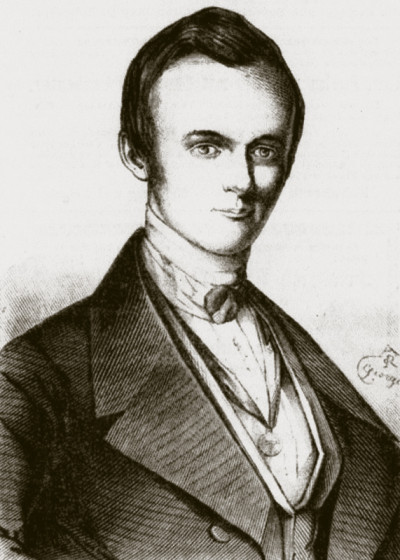In diesem Jahr gibt es gleich zwei Gründe über das o.g. Haus, Meißner Straße 159, zu schreiben: die spätklassizistische Villa in Radebeuls Mitte (Flurst. 911/3 Gem. Kötzschenbroda) steht seit nunmehr 140 Jahren; das rundere Jubiläum, nämlich das 50-jährige Bestehen, feiert der Kindergarten „Thomas Müntzer“ in dieser Villa. Ich selbst bin nicht in den Kindergarten gegangen, doch die ehemalige Leiterin des Kindergartens und spätere Rathauskollegin Frau Barbara Sehnert gab mir die freundliche Anregung, einmal über den Kindergarten etwas zu schreiben. Da es sich bei den Gebäuden und dem Park seit 1979 um ein Kulturdenkmal handelt, bin ich dem Wunsch nach etwas Recherchearbeit gern nachgekommen. Eine Feier in der Kindereinrichtung hat in diesem Jahr, im Mai glaube ich, bereits stattgefunden – ein herzlicher Glückwunsch zum 50-jährigen Bestehen sei hiermit den Kindern, den Kindergärtnerinnen und der aktuellen Leiterin, Frau Sylvia Schulz, von uns nachgereicht!
Denkmal und Kindergarten klingt erst mal ganz nett, von meiner Arbeit mit Radebeuler Denkmalobjekten weiß ich aber, dass es im Alltag immer auch ein paar spezielle Probleme außer dem Denkmalschutz zu lösen gibt, Stichwort Rettungsweg, Geländerhöhen bzw. Absturzsicherung, da müssen manchmal von beiden Seiten Kompromisse gemacht werden.
Doch ich will erst mal einen kleinen geschichtlichen Abriss zu dem Anwesen vorstellen.
Am 14. April 1873 wurden die für die Baronin Elise von Zehmen von der bekannten Baufirma Gebr. Ziller angefertigten Zeichnungen für den Bau einer Villa von der königlichen Amtshauptmannschaft für zulässig befunden. Auch die Ausführung lag in den Händen der von Moritz und Gustav Ziller geleiteten Firma. Wann die Ingebrauchnahme der Villa ausgestellt und diese bezogen wurde, ist nicht belegt. Wir werden aber kaum fehl gehen, dafür spätestens das Jahr 1874 anzunehmen. Die nach spätklassizistischen Merkmalen errichtete, zweigeschossige, verputzte Villa mit 17,5m Seitenlänge hatte nach Norden (Schauseite) und Süden je 5 und nach Osten und Westen je 4 Fensterachsen, darüber ein nach allen Seiten flach abgewalmtes Schieferdach mit oberer Plattform und Dreiecksgiebeln auf der Nord- und Südseite. Seitlich in symmetrischer Anordnung zur Villa finden wir zwei eingeschossige Funktionsgebäude (ursprünglich Gärtnerhaus und wohl Waschhaus mit Plättstube) mit geplanten Walm-, jedoch ausgeführten Satteldächern. 1876 kamen ein Gewächshaus an einem der Seitengebäude und 1887 noch ein größeres, freistehendes Gewächshaus dazu. Der südliche Gartenteil war ein Nutzgarten und diente vorwiegend zur Selbstversorgung. Nach Abtrennung der Sporthalle ist heute der Rest Spielgarten für die Kinder. Das Grundstücksteil zwischen Villa und Meißner Straße war von Anfang an ein Park mit Springbrunnen, wie wir es heute noch vorfinden. Nur sind die Bäume so prächtig gediehen, dass von dieser Seite kaum ein Foto von der Villa möglich ist.
Obwohl die Villa früher prächtig ausgestattet gewesen sein muss – so fand man 1986 bei Bauarbeiten im Erdgeschoss z.B. die Reste eines luxuriösen Bades mit abgesenkter Wanne -, war das Haus nur als Sommerhaus bzw. Zeitwohnsitz durch die Familie von Zehmen
genutzt, die in Dresden eine Stadtwohnung als Hauptwohnsitz hatte. Die vornehme Ausstrahlung dieser Villa ist m.E. in Radebeul vergleichbar mit der Weber-Villa (Meißner Str. 47) oder der Krüger-Villa (Neue Str. 12). Die verwitwete Baronin hätte in ihrem Testament verfügt, dass das Haus ein Kinderheim oder Ähnliches werden soll – klingt gut, ist aber auch nur überliefert. Weitere Einzelheiten zur Familie und auch die Lebensdaten der Baronin konnte ich bisher nicht finden. Es gab noch ein paar hier ungenannte Eigentümer bzw. Bewohner, die jedoch nur kurz in den Akten erwähnt werden und keine baulichen Spuren hinterließen.
Im Jahre 1911 erscheint als neuer Besitzer der Kommerzienrat Adolf Renschhausen und beantragt bei der Gemeinde Kötzschenbroda folgende baulichen Veränderungen an der Villa: eine Terrasse mit zwei geschwungenen Freitreppen auf der Eingangsseite, einen Kücheneingang auf der Ostseite, den DG-Ausbau mit runden Gaupen, eine Dachreling mit Fahnenstange und eine Zentralheizung. Dafür fertigt Architekt Paul Ziller die Zeichnungen an. Er hatte aber nicht das Format seiner älteren Brüder, bzw. durch ihn kamen andere Stileinflüsse zur klassizistischen Villa hinzu, so dass 1986 die beiden Freitreppen zugunsten nur einer mittigen Treppe wieder abgebaut wurden. Renschhausen war als Diplomat in Marokko tätig gewesen, weshalb er seinen Ruhesitz in Kötzschenbroda „Villa Tanger“ nannte. Eine Abbildung, die diesen Namen an der Fassade zeigt, ist mir aber nicht bekannt. Ob es unter Renschhausen bereits eine Kindereinrichtung im Hause gab, ist nicht anzunehmen, jedoch wird 1928 durch das Dresdner Hochbauamt ein Antrag für einen Anbau auf der Westseite und vergrößerte Dachgaupen für ein Säuglingsheim gestellt, der so genehmigt wurde. Die Stadt Dresden ist seit 1927 Eigentümerin der Immobilie und veranlasst 1949 hier die Unterbringung von griechischen Waisenkindern mit Betreuern (nach dem griechischen Bürgerkrieg mussten viele Kommunisten das Land für Jahre verlassen, wovon einige auch nach Radebeul kamen). Dieses interessante Kapitel soll hier nicht vertieft werden, es würde sich aber eine Erforschung lohnen, die in einen Artikel an anderer Stelle mündet. Während des 2. Weltkrieges diente die Einrichtung für kurze Zeit als Lazarett und 1945 richtete die „Rote Armee“ hier zeitweilig eine Kommandantur ein (aber es muss mehrere Häuser in Radebeul gegeben haben, die sich mal Kommandantur genannt haben).
1953 werden Grundstück und Villa der Stadt Radebeul übereignet, zunächst noch Kinderheim, kann dann 1963 der städtische Kindergarten „Thomas Müntzer“ hier entstehen. Viele Radebeuler Kinder haben ihn besucht und die allermeisten erinnern sich gern an diese Zeit. Sicherlich wurden über die Jahre hin Reparaturen und kleine Neuerungen im Inneren der Kindereinrichtung vorgenommen, nennenswerte bauliche Veränderungen, von einem scheußlich großen Schornstein (für Braun- oder Siebkohleheizung) auf der Westseite mal abgesehen, erfolgten bis 1986 nicht. Dann aber war ein Reparaturstau eingetreten, der eine Evakuierung der Kinder und eine umfangreiche Rekonstruktion erforderlich machte. Eine denkmalpflegerische Zielstellung dafür fertigte Architekt Helmut Leckscheid an, der dann auch das Projekt beim Kreisbaubetrieb Radebeul bearbeitete. Dass sich die Fertigstellung des Kindergartens bis 1990 hinziehen sollte, konnte zunächst keiner ahnen – der Einbau eines Speisenaufzugs war schwierig, Kostenüberarbeitungen führten zu Verzögerungen und schließlich brachte die Wende für die Baumaßnahme auch noch Probleme. Umso größer war die Freude bei den Kindern und auch den Erzieherinnen, als sie am 3. November 1990 wieder einziehen und künftig auch ein paar Verbesserungen nutzen konnten.
Bei all den Straßenumbenennungen, die die Wende mit sich brachte, ist es fast ein Wunder, dass der Name eines Führers aus dem Bauernkrieg – Thomas Müntzer – für den Kindergarten bis heute blieb!
Wieder vergingen ein paar Jahre der ganz normalen Nutzung der Kindereinrichtung. Etwa 2006 war die Diskussion zum 2. Rettungsweg (nach Bundesrecht müssen mehrgeschossige Kindergärten, Schulen und öffentliche Einrichtungen für einen angenommenen Brandfall eine zweite Treppe erhalten) dann so weit gediehen, dass ein Projektierungsauftrag an das Radebeuler Architekturbüro Clausnitzer vergeben werden konnte. Gut für das Denkmal, dass 2007 nicht eine der üblichen Minimalvarianten einer freien Stahltreppe oder einer Rettungsrutsche, sondern eine eingehauste Treppe auf der Südseite gebaut wurde. Anschließend, 2010, erarbeitete das Dresdner Architekturbüro Kunze + Zerjatke die energetische Verbesserung, Detailergänzungen und Farbgestaltung der Fassaden, so dass der Kindergarten in den nächsten Jahren ohne Gerüste, Staub und Lärm friedlich und in Ruhe weiter betrieben werden kann. Was dann noch fehlt, ist eine Neudeckung mit Schiefer, wie sie bereits die Gebr. Ziller ausgeführt hatten. Das hängt nun davon ab, wie lange das Preolithdach noch hält, bzw. wann die Stadt dafür wieder Geld ausgegeben kann. Die Vorübergehenden können sich also weiterhin an einem gepflegten Denkmal wie auch über das Kinderlachen an der Meißner Straße freuen.
Dietrich Lohse