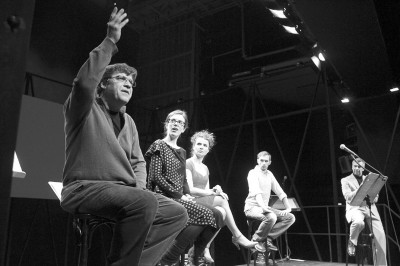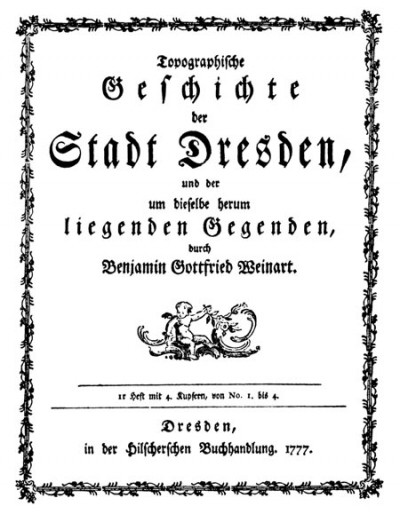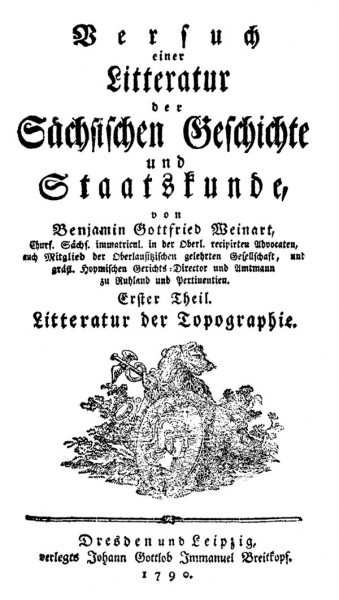Eine Ausstellung zum 125. Geburtstag des Radebeuler Malers Paul Wilhelm
»Paul Wilhelm ist der Vollender und letzte bedeutende Führer einer typischen Dresdner Malkultur, die kurz vor der Jahrhundertwende ihren Anfang nahm, alle Stürme eines halben Jahrhunderts überdauerte und heute geläutert in der dritten Generation eine Reihe trefflicher Vertreter als Beitrag zur deutschen Kunstgeschichte stellt.« Diese Einschätzung hatte der Dresdner Kunsthistoriker Dr. Fritz Löffler im Jahr 1956 getroffen, als sich Paul Wilhelm auf dem Höhepunkt seines Schaffens befand und dessen Werk weithin große Anerkennung genoss. So bot damals der 70. Geburtstag des Künstlers Anlass für Würdigungen der verschiedensten Art. Die Stadt Radebeul verlieh dem Maler und Beförderer des Radebeuler Kulturlebens im Jahr 1956 die Ehrenbürgerschaft. Retrospektiven fanden in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, in den Kunstsammlungen Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) und in der Nationalgalerie Berlin statt. Museen und Sammlungen erwarben von ihm Gemälde und Aquarelle. Eine Ehrenpension, die Paul Wilhelm ab 1960 erhielt, ermöglichte dem Künstler in seinen letzten Jahren das Arbeiten ohne Sorge um die Existenz. Als er im Jahr 1965 starb, hinterließ er ein umfangreiches künstlerisches Werk, welches in selten schöner Geschlossenheit zu treuen Händen in fachkundige Nachlassverwaltung übergeben werden konnte.

Paul Wilhelm (Foto aus Privatbesitz)
Seitdem ist wiederum fast ein halbes Jahrhundert vergangen und es stellt sich die Frage, welche Spuren der einst so geschätzte Künstler in seiner Wahlheimat und über deren Grenzen hinaus hinterlassen hat. Werke von Paul Wilhelm befinden sich in Museen und Sammlungen des In- und Auslandes, aber auch im Sächsischen Weingutmuseum Hoflößnitz und in der Städtischen Kunstsammlung Radebeul. Allerdings hätte der relativ leicht zugängige Bestand der Radebeuler Institutionen für eine Gedenkausstellung bei weitem nicht ausgereicht, zumal die der Hoflößnitz und dem Weinbau verbundenen Gemälde bei anderen Gelegenheiten der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen. So ist es schließlich sehr erfreulich, dass die Städtische Galerie Dresden, das Museum Bautzen und die Städtischen Sammlungen Freital Werke von Paul Wilhelm zur Verfügung stellten. Außerdem zeigten mehrere Radebeuler Bürger großes Entgegenkommen, in dem sie die Ausstellung durch bisher unbekannte Arbeiten – die ältesten sind mit dem Jahr 1903 datiert – aus ihrem Privatbesitz bereicherten. Leihgaben aus dem eingangs erwähnten künstlerischen Nachlass von Paul Wilhelm wurden von den jetzigen Besitzern für die Gedenkausstellung leider verwehrt. Und so ist die Ausstellung zum 125. Geburtstag von Paul Wilhelm auch ein Spiegelbild dessen, was eine kleine städtische Galerie mit ihren bescheidenen personellen wie finanziellen Ressourcen in heutiger Zeit zu leisten vermag.
Das Motto der Ausstellung »Das unvergänglich Schöne« wurde bewusst gewählt. Ihm liegt ein Zitat des Kunsthistorikers Prof. Dr. Werner Schmidt zugrunde, der im Katalog der Dresdner Aquarell-Ausstellung von 1966 feststellte, dass man in Wilhelms Werken »während der Kriegszeit zuweilen auch ein mühevolles Abschirmen, ein behutsames Wachhalten des unvergänglich Schönen gegenüber der Welt des Grauens« spüren kann. Diesen interessanten Gedanken könnte man fortführen, denn Paul Wilhelm ließ sich von keinem System vereinnahmen. Sein Werk war einzig und allein dem eigenen künstlerischen Anspruch verpflichtet und den Rankinglisten des heutigen Kunstmarktes würde Paul Wilhelm wohl völlig verständnislos gegenüberstehen.

Paul Wilhelm, Haus und Garten des Künstlers (Foto K. Gerhardt)
Paul Wilhelm wurde am 29. März 1886 in Greiz als Sohn eines Tuchfabrikanten geboren. Seine Ambitionen lagen sowohl auf naturwissenschaftlichem (Biologie und Zoologie) als auch auf künstlerischem (Malerei und Musik) Gebiet. Er entschied sich für die Kunst, speziell die Malerei. Im Jahr 1904 begann er in Dresden an der Kunstgewerbeschule zu studieren, doch schon bald wechselte er an die Akademie. Obwohl er Meisterschüler bei Gotthardt Kuehl wurde, fühlte er sich seinem Lehrer Oskar Zwintscher künstlerisch viel näher. Bereits im Jahr 1910 hatte Paul Wilhelm im legendären Kunstsalon von Emil Richter seine erste Einzelausstellung. Wenngleich die impressionistischen Einflüsse auf das Frühwerk unübersehbar waren, wurde dem jungen Maler eine ausgewogene künstlerische Reife zugesprochen.
Die Auseinandersetzung mit dem Expressionismus, vor allem mit den Künstlern der »Brücke« und des »Blauen Reiter«, die das Aquarell zu einer neuen Qualität erhoben hatten, führte dazu, dass die Aquarelle neben den Gemälden zum wichtigsten Bestandteil seines Schaffens wurden.
Mit dem Malerfreund, Wilhelm Claus (1882-1914), siedelte sich Paul Wilhelm im Jahr 1911 in Radebeul-Niederlößnitz an. Beide wohnten und arbeiteten im Turmhaus des Grundhofes. Als der junge Wilhelm Claus plötzlich verstarb, übernahm Karl Kröner (1887-1972) dessen Atelier. Paul Wilhelm blieb Karl Kröner bis zu seinem Tode eng verbunden, ebenso wie dem Dresdner Maler Theodor Rosenhauer. Ohnehin standen die in Radebeul ansässigen Künstler in einem beständigen geistigen Austausch mit einigen Künstlern aus Dresden und der näheren Umgebung wie Johannes Beutner, Erich Fraaß, Otto Griebel, Hans Jüchser, Fritz Winkler und Joseph Hegenbarth. Ab Anfang der 30er Jahre, als es nicht ungefährlich war sich mit Gleichgesinnten zu treffen, gab man vor, sich ausschließlich zum Wandern zusammen zu finden und so kam der Begriff von den so genannten »Spaziergängern« auf.

Marion Wilhelm, lesend, 1933
Gemeinsam mit seiner amerikanischen Frau Marion bezog Paul Wilhelm im Jahr 1920 eine kleine Villa auf dem Gradsteg. Haus und Garten strahlten eine gewisse Noblesse und spätbürgerliche Kultiviertheit aus. Wem es vergönnt war, dieses Refugium zu betreten, geriet unweigerlich ins wortschwelgende Schwärmen. Paul Wilhelms »Phantasie entzündete sich nur am Besonderen und Erlesenen« schrieb Dr. Fritz Löffler 1948 in einem Katalog. Wilhelms Musikalität verwob sich mit einem ausgeprägten Farb- und Formempfinden, was in seinen Kunstwerken als auch in seinem unmittelbaren Umfeld zum Ausdruck kam. Man liebte die Geselligkeit, lud zu Gesprächen und kleinen Konzerten. Den Alltag organisierte die »Wilhelmine«. Sie pflegte Kontakte und Freundschaften, beschaffte alles was zum Leben notwendig war. Neben seinem Wirken als Künstler, erwarb sich Paul Wilhelm Anerkennung als Züchter von Delphinium-Hybriden (Rittersporn) und Sammler von alten Schellackplatten mit Aufnahmen der menschlichen Gesangsstimme. Ein herzliches Verhältnis verband Marion und Paul Wilhelm auch mit dem jungen Künstlerpaar Ute und Werner Wittig.
Paul Wilhelm erlegte sich selbst eine thematische Beschränkung auf, die er zeitlebens beibehielt. Sein Werk reifte in Zurückhaltung und Stille. Reisen ließen ihn nicht unbeeindruckt und fanden beachtenswerten Niederschlag in seinem Schaffen. Doch mit der Lößnitz hatte er seinen eigentlichen Sehnsuchtsort gefunden. Immer wieder stellte er die Blumen in seinem Garten und die ihn umgebenden Lößnitzberge im Wandel der Jahreszeiten dar, vor allem jedoch im Frühling und im Herbst. Eine große Faszination übte auf ihn dabei die magische Wirkung des Lichtes aus. Figürliche Darstellungen und Porträts interessierten ihn mit zunehmendem Alter immer weniger, mit Ausnahme ihm nahe stehender Personen, wie Kinder, die er sehr liebte, und natürlich Frau Marion. Radierungen bildeten in seinem Schaffen eher eine Ausnahme und Zeichnungen dienten ihm vorwiegend als Vorarbeit für die im Atelier entstandenen Bilder. Als seine Kräfte zu schwinden begannen, wendete er sich der Aquarellmalerei zu, die er zu höchster Vollendung führte.
Paul Wilhelm, einer der bedeutendsten Vertreter der »Dresdner Malkultur«, ist aus dem öffentlichen Bewusstsein der Dresdner Kunstmuseen nahezu verdrängt. Ein Werkkatalog steht noch aus. In Radebeul erinnert der »Professor-Wilhelm-Ring« an den Künstler. Und was nur Wenigen bekannt sein dürfte ist die Tatsache, dass im Luthersaal der Radebeuler Friedenskirchgemeinde der originale »Paul-Wilhelm-Flügel« steht. Mit der Gedenkausstellung, die bis zum 8. Mai in der Radebeuler Stadtgalerie zu sehen ist, verbindet sich die Hoffnung, dass dieser Ausstellung weitere an anderen Orten folgen mögen und die Kunst eines Paul Wilhelm vor allem unter den jüngeren Menschen neue Freunde findet.
Karin Gerhardt, Stadtgaleristin