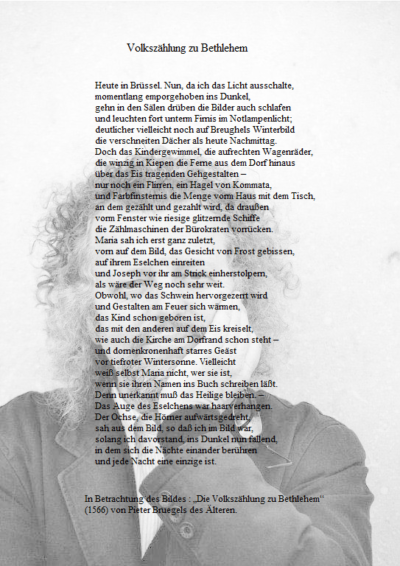Am 15. November 2019 wurde durch die Stadt Radebeul und den Verein für Denkmalpflege und Neues Bauen Radebeul e.V. zum nunmehr achtzehnten Mal der Bauherrenpreis der Großen Kreisstadt Radebeul verliehen. 21 Einreichungen in den drei ausgeschriebenen Kategorien Garten- und Freiflächengestaltung, Denkmalpflege und Sanierung sowie Neues Bauen sorgten für die notwendige Spannung und intensive Diskussion in drei Jurysitzungen; sie werden auch langfristig optisch unsere Stadt bereichern. Damit konnten in der Stadt seit 1997 nunmehr 81 Objekte mit der begehrten Plakette ausgezeichnet werden.
Festzuhalten bleibt, dass über die Jahre hinweg immer nur sehr wenig Gärten und Freiflächen eingereicht werden, diesmal wieder nur zwei. Unser Selbstbild ist doch aber gerade (noch??) ein anderes: wir sehen unsere Stadt als Villen- und Gartenstadt; die Villen benötigen geradezu einen angemessenen Garten, sonst wären es keine. Oder wird Radebeul sukzessive eine Stadt der Ein- und Zweifamilienhäuser, der Doppelhaushälften und der sog. Stadtvillen? Auch die Freiflächen, im engeren Sinne die gestalteten Plätze, geben unserer Stadt erst ihr Flair. Hier ist aber erkennbar, dass sich Verwaltung und Bürger gleichermaßen um diese wichtigen Zäsuren bemühen, das öffentliche Bewußtsein dafür sehr ausgeprägt ist. Viel wurde schon geschafft: sei es der Robert-Werner-Platz, die Anger in Zitzschewig und Naundorf, der Fontänenplatz, der Platanenplatz, der Bilzplatz, der Rosa-Luxemburg-Platz und nunmehr der Karl-May-Hain. Fehlt zukünftig noch der Ziller-Platz; hier ist dringender Handlungsbedarf geboten.
Wenn mit den Gärten und Freiflächen die Lunge Radebeuls angesprochen ist, so dann mit der Kategorie Denkmalpflege und Sanierung das Herz unserer Stadt; diesmal waren es 15 Einreichungen, so dass sich die Jury entschloss, in dieser Kategorie je einen Preis für sanierte Altbausubstanz und einen für die fachgerechte Denkmalsanierung zu vergeben. Unser Festredner, Landeskonservator a. D. Prof. Dr. Heinrich Magirus, ging auf den Wert dieser historischen Bausubstanz eindringlich ein und machte deutlich, dass von diesen – und nicht von Neubauquadern – etwas in die Seele der Anwohner und im positiven Sinne Flaneure zurückwirkt. Diesen stadtbildprägenden Wert nahm auch die Jury in ihren Diskussionen auf. Überhaupt greifen die Diskussionen in der Jury naturgemäß immer weiter als nur auf die einzelnen Baulichkeiten. Nicht zuletzt merkt man den Diskussionen ihre Befreiung von den sonstigen rechtlichen Zwängen an, die manchmal gleich Denkgrenzen markiere. Die inhaltlichen Ideen und fachlichen Hinweise der Jury sollten für die Verwaltung und den Stadtentwicklungsausschuß nutzbar gemacht werden.
Am meisten verändern unsere Stadt natürlich die Neubauten, von denen 4 Objekte eingereicht wurden. Neubauten allgemein sind daher auch Schwerpunkt bei der Beurteilung der Stadtentwicklung, sie geben Hinweise auf Rücksichtslosigkeit gegenüber der gewachsenen Stadt oder den Willen zur Einfügung (nach Größe usw.) und auch dem Einpassen, was nichts anderes meint als der Suche nach Harmonie mit dem hier Vorhandenen. Ein Neubau kann schön sein – und doch den Straßencharakter zerstören. Er muss auch nicht historisieren. Schwer ist immer das „richtige“ Maß, für das es auch gar keinen für jedermann gleichermaßen fassbaren Rahmen gibt. Neues Bauen ist weder Kopie noch purer Selbstzweck mit sich als alleinigem Maß; es positioniert sich, fügt sich ein, anerkennt die Umgebung und respektiert Natur und Nachbarn. Es gilt, dies wurde in letzter Zeit deutlich, den „erhalt des besonderen Charakters der Stadt Radebeul“ klarer in Worte und Handlungen zu übersetzen. Denn wie zitierte Gabriele Schirmer nicht Winston Churchill: „Wir formen unsere Gebäude, danach formen sie uns.“
Zur Preisverleihung konnte das Vorstandsmitglied der Sparkasse, Herr Daniel Höhn, rund 150 Besucher, darunter Oberbürgermeister Bert Wendsche, in den Räumen der Sparkasse Radebeul West begrüßen. Die Sparkasse hatte darüber hinaus, wie schon in den letzten Jahren, freundlicherweise dafür gesorgt, dass alle Gäste in angenehmer Atmosphäre bei kleinen Snacks und anregenden Getränken zu ebensolchen Gesprächen über Baukultur und mehr verweilen konnten. Ein Grußwort sprach Dr. Jörg Müller, 1. Bürgermeister der Großen Kreisstadt Radebeul, der nicht zuletzt die notwendigen Erhaltungssatzungen für die Ober- und Niederlößnitz in den Blick nahm.
Innerhalb der zwei Ausstellungswochen in der Sparkasse Radebeul-West bis zur Preisverleihung hatten diesmal sage und schreibe 318 Bürger (!) wieder von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihren Publikumsfavoriten zu wählen. Der Entscheidung der Jury (drei Vertreter der Stadtverwaltung, drei Vertreter des Stadtrates und sechs Vertreter des Vereins), die kein reines Fachgremium ist und in einem geheimen Wahlgang entscheidet, wurde damit die öffentliche Meinung gegenübergestellt.
In der Kategorie „Denkmalpflege und Sanierung“ gab es 15 Vorschläge und einen geteilten Preis. Der Bauherrenpreis für die Denkmalpflege ging an das Kyauhaus Wettinstraße 2, der für Sanierung von Altbausubstanz ohne Denkmaleigenschaft an die Johannisbergstraße 5 in Naundorf, die zugleich den Publikumspreis in dieser Kategorie erhielt. Die Laudatoren (Denkmalpflege Andre Schröder, Sanierung Robert Bialek, Neues Bauen Gabriele Schirmer, Gärten Dr. Grit Heinrich/Jürgen Tauchert; die jeweilige Laudatio bildet auch die Grundlage für die vier kurzen Objektbeschreibungen) würdigten in fundierten Beschreibungen die Objekte und machten deutlich, warum gerade diese den Preis erhielten.
In der Kategorie „Neues Bauen“ gewann von den vier Einreichungen das neue Gemeindehaus der Lutherkirchgemeinde. Der Publikumspreis ging dagegen an die Obere Bergstraße 81.
In der Kategorie „Freiflächengestaltung“ musste aus diesmal nur zwei Objekten ausgewählt werden, die zudem ganz unterschiedlich in ihrer Ausdehnung und Anspruch sind. Hier entschied sich die Jury für den Karl-May-Hain, das Publikum hingegen sprach den Preis mit jeweils 276 Stimmen beiden Objekten zu.
Der Verein wird in 2020 wieder einen Stadtspaziergang zu verschiedenen Preisträgern anbieten, immer in der Hoffnung, bei Bauwilligen somit das Bewusstsein zu schärfen, was für Radebeul passt. Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden – ob Bauherr, Einreicher, Jurymitglied, Sponsor oder interessierter Bürger; ebenso bei der Druckerei Krause für die Einladungen und beim Grafiker Matthias Kratschmer, der wie gewohnt für die Urkunden, Plakate und Plaketten verantwortlich zeichnete. Wir gratulieren allen Preisträgern und bedanken uns für die großzügige Unterstützung der Sparkasse Meißen.
Dr. Jens Baumann
Kategorie Neues Bauen
Bereits seit Ende der 1990 Jahre suchte die Lutherkirchgemeinde nach räumlichen Erweiterungsmöglichkeiten für ihre Gemeindearbeit. Den Architekturwettbewerb entschied das Büro knoche_architekten aus Leipzig für sich. Ausgezeichnet werden konnte nunmehr ein rechteckiger langgestreckte Baukörper, der gemäß der denkmalpflegerischen Vorgaben als Baustein zwischen Kriegerdenkmal, Lutherkirche und der südlichen Bebauung des Grundstücks eingeordnet wurde. Als Knotenpunkt vermittelt er zwischen der Kirche als Andachtsraum sowie den Pfarrhäusern als Sitz der Verwaltung. Das neue Kirchgemeindehaus bindet in das nach Süden abfallende Gelände ein, tritt als Volumen zurück und belässt der Lutherkirche ihre Wirkung als Solitär. Außenwände aus farblich auf die Fassadenfarben der Kirche abgestimmtem Ziegelmauerwerk und große, einheitlich gegliederte Glasfronten prägen das ruhige, ausgewogene äußere Erscheinungsbild. Vor dem zurückgesetzten südlichen Eingang wurde ein überdachter Vorplatz geschaffen; unter der als Umgang und auch Fuge zwischen Alt und Neu dienenden Außentreppe verläuft die geschickte barrierefreie Anbindung des Neubaus an das Kirchenschiff. Betritt man das neue Gemeindehaus, ist man erstaunt über die klare Gliederung und das von außen so nicht vermutete großzügige Platzangebot. Auch hier wirkt die Reduktion der Materialien auf Putz, Estrich, Holz und Glas wertig und angenehm zurückhaltend. Es ist ein in sich schlüssiges Gebäude entstanden, das in seiner langlebigen, fein austarierten Formen- und Materialsprache beispielgebend nicht nur für Radebeul ist.
Kategorie Denkmalpflege
Als vor knapp 20 Jahren die Bebauung des Dichterviertels begann, gab es noch einenfantastischen Blick von der Karl-Marx-Straße über das Feld zur Jungen Heide und einigen Häusern unterhalb der Berge der Oberlössnitz. Ein Haus hob sich schon damals besonders hervor mit seinem hellen Anstrich, dem steilen Walmdach, mit den in zwei Reihen übereinanderliegenden Schleppgauben und dem hohen Schornstein. Im Volksmund heißt es „Kyau-Haus“; obwohl gerade diesem Bauherrn, dem Königsteiner Festungskommandanten Friedrich Wilhelm von Kyaw (1654 – 1733) aus oberlausitzschen Uradelsgeschlecht, der Besitz nicht nachgewiesen werden kann. Nachgewiesen als Besitzer ist hingegen der Architekt Samuel Locke (1710 – 1793). Er übernahm das Weingut in der Oberlößnitz 1754 käuflich. Ende 2014 wurde das historisch bedeutsame Haus durch die Herren Jacob Reichstein und Jens Güldemann käuflich erworben. Fachwerk musste ausgewechselt werden, Zwischenwände und Deckenverkleidungen wurden entfernt, die Kellertonne freigelegt, insgesamt fielen 20 Container Bauschutt an. Nun gibt es 80 Seiten Befunderhebung, barocke und junge Wandmalereien wurden aufgespürt. Das nun wiederhergestellte Treppenhaus und der restaurierte Festsaal mit dem Stuck und Deckenmalereien spiegeln den Sächsischen Barock zu Lockes Zeiten wider. Der ehemals stark renovierungsbedürftige Zustand des Gebäudes wurde im Sinne des Denkmalschutzes mit viel Liebe, Sorgfalt und Sachkenntnis in allen Bereichen saniert. Nun gilt es Danke zu sagen.
Kategorie Sanierung Altbausubstanz (ohne Denkmaleigenschaft)
Als Zweifamilienhaus 1899 in einer für Naundorf in jener Zeit nicht untypischen Weise gebaut, wurde das Gebäude Johannisbergstraße 5 im Jahr 2007 von Familie Jentzsch in heruntergewirtschaftetem Zustand erworben und im letzten Jahrzehnt durch die Eigentümer mit hohem Aufwand und der heutigen Wohnnutzung entsprechend instandgesetzt. Beauftragte Handwerker aus der Region haben mit Hand angelegt. Der zur Straße hin traufständige Bau mit Mittelrisalith incl. Giebeldreieck trägt schlichte klassizistische Züge des 19. Jahrhunderts. Es handelt sich um einen teilunterkellerten zweigeschossigen Putzbau mit Bruchsteinsockel und schieferähnlichem Prefa-Dach. Nebengebäude und die historisierende Einfriedung ergänzen das Grundstück. In der Denkmalliste von Radebeul ist kein Eintrag vorhanden, was die Bauherren aber nicht davon abgehalten hat, viele Details an der Fassade und im Inneren des Hauses wieder zu rekonstruieren oder zu restaurieren. Dachdeckung, Gesimse, Glattputz, Putzzierrat, zurückhaltende Farbgebung, liebevoll geschliffene und reparierte Sandsteingewände der Fenster und Türen und der sanierte Bruchsteinsockel geben dem Haus wieder seinen vornehm-schönen Charakter zurück. Dieser wird durch das wieder bepflanzte Weinspalier an der Straßenfassade in hervorragender Weise ergänzt. Im Inneren des Hauses sind besonders die wieder sehenswert aufgearbeitete Bestandsdielung der Fußböden und die restaurierten Wohnungs- und Eingangstüren mit ihren dazugehörigen Kastenschlössern, Beschlägen und originalen Verglasungen hervorzuheben. Die Einfriedung entlang der Straße trägt durch die gut sanierten Bruchsteinmauerenden, den Holzzaun aus Lärche und die dem Original nachempfundenen Betonsäulen zum guten Sanierungserfolg bei. Insgesamt ein nachahmenswertes Beispiel für eine Altbausanierung!
Kategorie Gärten und Freiflächengestaltung
Der Karl-May-Verein legte 1932 zu Ehren des Schriftstellers den Karl-May-Hain an. 1992 wurde dieser als öffentliche Parkanlage umgestaltet und 2017 / 2018 im Auftrag der Stadtverwaltung Radebeul durch das Büro Rehwaldt Landschaftsarchitekten und den Holzdesigner Alexander Fromme attraktiv aufgewertet und erweitert. Die ursprüngliche Anlage wurde in Teilbereichen saniert und durch punktuelle Eingriffe attraktiver gestaltet. So wurden die Wegeführung überarbeitet, die Pflanzungen ergänzt und der Bestand behutsam denkmalgerecht erhalten. Schwerpunkt war die mit der Erneuerung der Wassertechnik verbundene Sanierung der Wasserläufe sowie der Wasserbecken des Silber- und des Herzsees. Wie die fünf Kontinente, über die Karl May schrieb, fließen jetzt nach ca. 50 Jahren wieder fünf Bachläufe. Die Erweiterung der Parkanlage erfolgte in östlicher Richtung in Form eines Spiel- und Erlebnisbereiches für die jüngeren Besucher des Karl-May-Museums. Karl Mays Buchthemen sind für die Kinder lebhaft und plastisch umgesetzt. Vom Silbersee zieht die Karawane in die Wüsten Arabiens, dem Schauplatz der Abenteuer Kara Ben Nemsis. Da tummeln sich gelbbraune Kamele zum Schaukeln und Wippen, goldgelbe Dünen und Schluchten sind zu erkunden, rote Berge und eine goldene Wüstenstadt leuchten im Hintergrund, kräftig grüne Kakteen laden zum Klettern ein. Es gibt Hinterhalte, Rutsch-, Balancier- und Hangelmöglichkeiten, eine Schatzhöhle uvm. Und manchmal ist es auch heiß wie in der Wüste. Die Erweiterung mit den bespielbaren Holzkonstruktionen und mit Bänken und Tischen in erfrischendem Outfit ist nicht nur für die kleinen Besucher und Fans des Karl-May-Museums attraktiv, sondern auch für die umliegenden Anwohner und Kitas ist die Anlage ein Gewinn. Der denkmalgeschützte Pavillon wurde als öffentliches WC umgenutzt; auch dies ist wichtig und nicht zuletzt für die Pflanzen im Park ein Gewinn. Durch die Wegverbindung zur Schildenstraße konnte der vormalige „Sackgassen“-Charakter des Parks aufgelöst werden. Die Anlage ist gestalterisch, museumspädagogisch, qualitativ und funktionell sehr gut gelungen und eine bespielgebende Bereicherung unserer Freianlagen – abseits einfacher Standardlösungen.