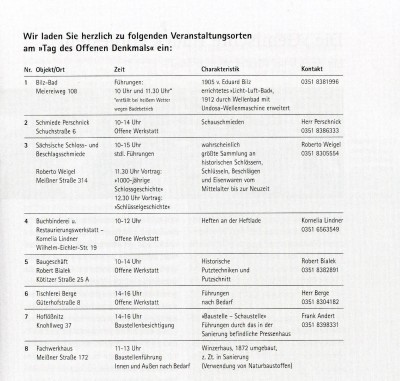Tilo, mein lieber Freund,
jetzt teilen sich die Reihen, Du schreitest hindurch, TShirt, schnell das flatternde Hemd noch zurechtgezogen – „Ach, es geht schon los, dann will ich nicht stören, macht ruhig weiter“. Und schon sitzt Du mitten unter uns.
Nach ein paar Sekunden schaust Du in die fragende Runde und meinst: „Also wenn niemand was sagt, dann fange ich eben an.“ Und kommst nach vorn, um uns beizustehen. … So ungefähr muss es 1986/1987 noch während des Studiums gewesen sein, als sich Architekturstudenten, unter ihnen Du, an der TU Dresden Gedanken darum machten, ob Altkötzschenbroda wirklich abgerissen werden sollte. Der Erhalt und die Instandsetzungen tragen Deine Handschrift mit. Und so war es beim Denkmalaktiv und später beim Verein. Und so war es auch bei der großen Flut. Eigentlich war es immer so: Du hast eine Idee skizziert und mit ihr aufgefordert zum unmittelbaren Handeln.
Und bestimmt hatte damals jemand gesagt: Das geht doch so nicht, Herr Kempe. Ein für Dich, Tilo, unerträglicher Satz, ein Satz, den Du nie akzeptieren wolltest. Dein Standpunkt war immer klar und fest: „Alle sagten: das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat‘s einfach gemacht.“
Tilo, das war nicht nur ein Spruch von Dir, sondern das warst Du. Du selbst. Machen, das unmöglich Scheinende möglich machen, viele Bauherren haben dies von Dir erhofft; und auch ganz oft bekommen. Dabei warst Du nie ohne Plan, aber Du warst eben auch nie nur Plan. Denken und Handeln gehörten für Dich untrennbar zusammen. Du wurdest nicht Deichgraf, weil einer vorn stehen musste, sondern der Respekt vor Deiner Rettungsleistung, z. B. der Verzinkerei, machte Dich dazu. Da war einer, der es eben konnte.
Und nur so konnte man auch Dein Freund werden: durch Mitmachen. Mitmachen war dann alles: auch beim Joggen musste ich mitmachen, dafür hast Du wundervolle Karpfen gezaubert. Wir hatten uns um die Zeit der friedlichen Revolution herum kennengelernt, Du hattest beim Büro Dr. Jäger gearbeitet, warst dann mit dem Flächennutzungsplan befasst. Und hast mich mit hinzugezogen. Die Freundschaft kam über eine gemeinsame Sache, ich kenne keinen, der das anders sagen würde. Die gemeinsame Sache war Dir immer wichtig – und deshalb konnte ich bei Dir auch immer Menschen unterschiedlicher Ansichten finden, wenn sie nur für eine gemeinsame Sache Streiter sein wollten. Hauptsache war Dir, so habe ich es gefühlt, zuallererst Radebeul und sein Baugeschehen – ob als Bauherr, Stadtrat oder als Architekt. Zuletzt lag Dein Augenmerk auf der Meißner Straße, die Du gern als funktionierend und entlastend für die Wohngebiete gesehen hättest.
Bei Dir konnte man Menschen treffen, denn Dich hat das offene Haus ausgemacht, welches Du führtest. Zu Dir konnte jeder jederzeit kommen. Auch wenn der Hausherr einmal nicht da war oder später kam. Aber wenn er da war, kam nie das Wort „keine Zeit“, es wurde sich hingesetzt, irgendetwas gab es zu trinken und dann wurde gequatscht bis in die Nacht, diskutiert. Eine wahnsinnig schöne intensive Zeit. Manchmal sind wir dann noch in die Oase nach Altenberg gefahren, dort lässt sich Kraft tanken, ein wundervoller familiärer Anker, wo sich auch mal alle Geschwister trafen, ich denke gern an den Geburtstag letztes Jahr.
Tilo, Architekt sein war Dein innerstes Selbst. Du konntest gestalten. Schon 1992 fungierte Dein Haus nach einem Aufruf in Vorschau und Rückblick als Treffpunkt derjenigen, die Radebeul als Wein- und Gartenstadt bewahren und zugleich erneuern wollten. Im Winzersaal begegneten sich Familie und Verein, ein Ort der freien Diskussion, in ihm entstanden Ideen, die heute Radebeul mit prägen. Ich erinnere mich immer wieder gern an den Februar 1993, als ich mehr zufällig vorbeikam und von Dir hörte. „Jens, bleib gleich mal hier, wir gründen gerade einen Verein, Du hast doch Ahnung von Zahlen, Du kannst den Schatzmeister machen.“ Und so war man plötzlich in Deiner Sache mittendrin, der Du auch immer wieder mit Impulse geben konntest wie den Bauherrenpreis. Eine super Idee, nicht das Schlechte vorzuführen sondern das Schöne als beispielgebend öffentlich zu würdigen. Auch Deine Häuser tragen ja dieses Gütesiegel. Chef sein wolltest Du übrigens selbst nicht, Stellvertreter reicht ja; ein Architekt braucht ja auch Freiräume: Die kann, wer will, sich erkämpfen, aber besser: nehmen. Frag nicht so viel, mache.
So war es auch nur konsequent, dass Du Dir Deinen Traum vom Fliegen erfüllt hast. Du bist Flieger geworden. Den wunderschönen und funktionstüchtigen Modellen in Altenberg, am 11. Juli hattest Du sie mir noch einmal vorgeführt, folgten Ultraleichtflugzeuge. Da konntest Du fotografieren, Problembereiche für die nächste Flut ausmachen und weitergeben; beim Fliegen kann man sich seiner Sorgen auch mal entheben. Tja Tilo, „hoch über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.“ Genauso hast Du gedacht und unterschieden, was ist wirklich wichtig und was hält nur auf und ärgert. Und am 21. August im Krankenhaus hattest Du mich auch noch gefragt: „Vielleicht will er mich ja doch noch gar nicht. Und Jens, wie wird das mit der Wiedergeburt?“ Wir waren uns dann mit einem Schmunzeln schnell einig, dass es ja nicht so schön sein kann, wenn alle im Himmel so rumlaufen, wie wir uns hier täglich auf der Erde sehen. Aber, hast du gesagt, „geistig bleibt doch was.“ Besonders eure doch noch so kleine Lilly lag Dir am Herzen, alle die Dich mögen, sollten ein Auge auf sie werfen, Edeltraut helfen wenn Hilfe gebraucht wird.
Und was bleibt, mein Freund?
Das Unwiderrufliche wird mir erst jetzt immer klarer, und wie die Zeit unaufhörlich geschäftig Tribut fordert. Freiheit, Zeit nehmen, ein offenes Haus leben, Freundschaften pflegen, das können wir uns von Dir merken. Mit Deiner Geradlinigkeit bist Du immer ein politischer Mensch gewesen, aber Du bist kein Politiker geworden. Unmittelbar sein, das hat Dich ausgezeichnet. Ich denke, das haben Deine Familie, Deine drei Geschwister, Deine beiden Ehefrauen und Deine drei Kinder, Deine Freunde und Wegbegleiter an Dir geschätzt, das hat Dich zum Freund werden lassen. Die anderen haben es an Dir gefürchtet.
Gibt es ein Wiedersehen, das hat Dich noch umgetrieben. Ja, Tilo, das gibt es. Das offene Haus habe ich auch so am 23. August in Deinen letzten Stunden vorgefunden, Freundschaften sind auch über Dich entstanden. Und wenn wir durch Radebeul gehen, wird allerorts etwas von Dir zum Wiedersehen einladen, ob in Altkötzschenbroda, auf der Weinberg- oder der Winzerstraße. Deine Gabe hast Du genutzt. Und nicht zuletzt wird auch Deine Stufe im Turm Dich im Hier behalten. Du bist nur schon vorausgestiegen, viel zu eilig.
Auf Wiedersehen, mein guter Freund,
Auf Wiedersehen, Tilo