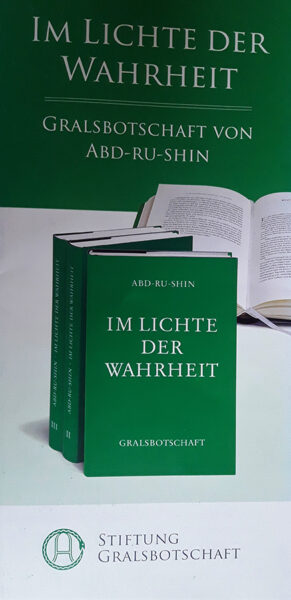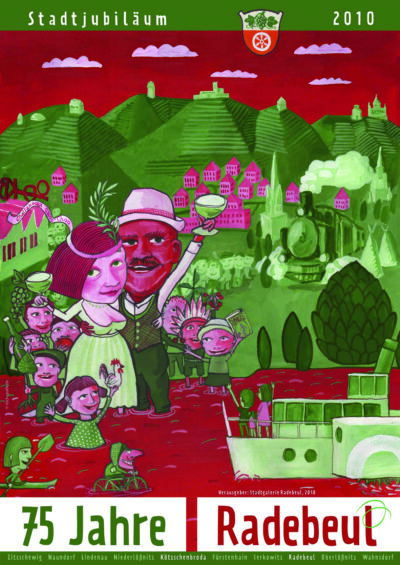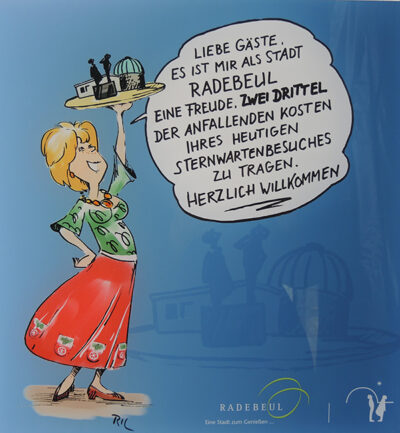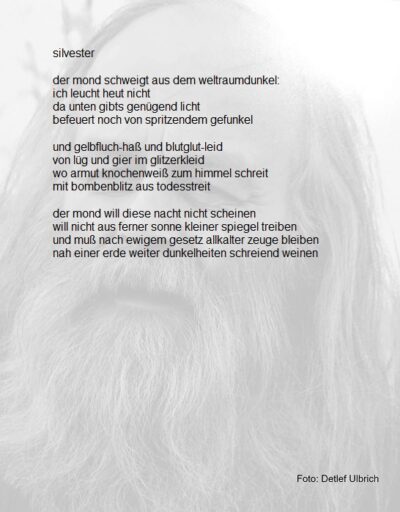Keramische Rauchrohre in Radebeul
Einleitung
Man sieht sie fast nicht wenn man durch unsere Stadt spaziert. Man nimmt die Häuser meist als Ganzes wahr und achtet weniger auf ein eher unscheinbares Detail weit oben. Und es ist ein sehr spezielles Thema, ja eigentlich ein technisches Detail, das durch das Design, hier schmückende Blumenkränze, da räumliche, an eine Skulptur erinnernde keramische Gebilde, ein wenig an Kunst denken lässt, aber was man nicht als Kunst im engeren Sinn bezeichnen würde. Wenn ich zu diesem Thema eine Reise nach England unternommen hätte, würde ich bei der Gestaltung und auch bei der Anzahl und Wirkung der keramischen Rauchrohre schon eher von Kunst, bzw. Baukunst sprechen wollen. Denken wir nur an die Schlösser, Herrenhäuser und Cottages auf der Insel, die in der Dachlandschaft von vielen Schornsteinen mit phantastischen Aufsätzen bekrönt werden. Ein klein bisschen von diesem „sich in UK befinden“ kann man auch in Radebeul erleben. Dass es außer diesen keramischen Schornsteinaufsätzen um 1900 auch solche aus Metall, die von weitem einem Ritterhelm ähnelten, gab, sei hier nur am Rande vermerkt.
Gegenstand und Standorte
Bei meinen Streifzügen durch Radebeul konnte ich vier verschiedene Baugruppen dieser keramischen Schornsteinaufsätze unterscheiden, zum größten Teil noch am originalen Standort, also auf dem jeweiligen Schornstein, zum geringeren Teil als Sammelstück im Garten und da auch als ein Blumentopf im Sinne einer Zweitverwendung. Als Höhen dieser Rohre konnte ich 1,20 – 1,50m und als äußerer Durchmesser 150, 175 u. 200mm feststellen. Diese Keramikrohre wurden innen und außen mit brauner Glasur versehen und sind recht witterungsbeständig. Die Rohrdurchmesser passten jeweils genau in die damals üblichen, viereckigen Schornsteinabdeckplatten aus Sandstein mit rundem Loch.
Typ 1 ein runder, oben und unten auskragender offener Keramikzylinder mit zwei floralen Ringgestaltungen. Dieser Typ kommt nur einmal in Radebeul vor, nämlich bei der ehem. Kegelbahn der Kolbe-Villa von 1891, Zinzendorfstr. 16.
Typ 2 runder Keramikzylinder, oben mit zwei Wülsten, dazwischen leicht auskragende Stege im Wechsel mit Abzugsöffnungen und einem keramischen, an eine Kaffeekanne erinnernden, abnehmbaren Deckel. Wenn der Schornsteinfeger kommt, muss er erst den Deckel abnehmen, kehren und dann den Deckel wieder draufsetzen. Der Typ kommt mehrmals, z.T. mehrfach auf je einem Haus in Radebeul vor – Neue Str. 12 (erbaut 1862), Meißner Str. 289 (errichtet 1868), einmal in der Oberen Bergstr. 30 und in der Karlstr. 8.
Typ 3 rundes Keramikrohr mit oberer Wulst, darunter vier seitlich abstehende, nach unten geneigte, kleinere Rohre als Zuluft, oben wohl offen (dieses Dach konnte ich nicht begehen). Den Typ fand ich dreimal auf den Schornsteinen der Villa Zinzendorfstraße 1 (erbaut 1880).
Typ 4 auf einem runden Keramikrohr sitzt oben ein breiterer, sich nach oben verjüngender Kegelstumpf, der auf der Unterseite Lufteintrittsöffnungen hat und oben offen ist. Der Typ ist in Radebeul am häufigsten zu finden, nämlich an den Adressen Karlstr. 8 (errichtet 1872), Schumannstr. 25, Zinzendorfstr. 1, Borstr. 57, Kynastweg 26 und Altwahnsdorf 45. Ich war für baß überrascht, dass ich bei einem Ausflug zur Festung Königstein 5 oder 6 Rauchrohre vom Typ 4 über den Kasematten entdeckte, wobei mir schon klar war, dass dieselben nicht auf Radebeul beschränkt sein dürften.
Zweck der keramischen Schornsteinaufsätze
Derartige keramische Rohre wurden da auf normal hohe, gemauerte eckige Schornsteine mit rundem Schlot aufgesetzt, wo die Zughöhe (als Faustregel gilt mind. 4m über der Feuerungsöffnung eines Kachelofens oder einer anderen Feuerstätte bis Schornsteinkopf) nicht ausreichte. Das war meist da erforderlich, wo im DG ein Raum mit Ofenheizung vorhanden war. Ein zweiter Fall des Einsatzes eines keramischen Rauchrohrs bestand da, wo ein Haus zwei unterschiedlich hohen Gebäudeteile hatte und auch der niedrigere Gebäudeteil beheizt werden musste. Da setzte man dem Schornstein des niedrigeren Teils oft ein Keramikrohr auf wegen eines besseren Rauchabzugs. So konnten in manchen Fällen extrem hohe gemauerte Schornsteine auf Wohnhäusern vermieden werden.
Zeitliche Einordnung und Hersteller
Die keramischen Schornsteinaufsätze waren eine „Mode“ in der 2. Hälfte des 19. Jh., wie ein paar o.g. Beispiele belegen. Sie wurden aber z.T. noch bis in die Mitte des 20. Jh. hergestellt. Als Betriebe kommen ganz allgemein solche in Frage, die in größeren Mengen gemuffte Steinzeugrohre für erdverlegte Regen- und Abwasserleitungen produzierten, bzw. die sich in der Nähe von abbaubaren Tonvorkommen befinden – Ton ist der Hauptbestandteil der 4 Typen von Schornsteinaufsätzen. Mir ist es in 2 Fällen des Typ 2 gelungen, den Hersteller durch in den noch weichen Ton eigeprägte Schrift und Zahlen in Mittelsachsen ausfindig zu machen: „Baerensprung & Starke“, Frankenau bei Mittweida (heute eingemeindet nach Mittweida), 150 und 200 (äußerer Durchmesser in mm). Der Firmenname hatte sich, wie mir von der Stadtverwaltung Mittweida im August 2021 mitgeteilt wurde, zwischen 1852 und 1965 noch ein paar Mal geändert, Steinzeugrohre und Schornsteinaufsätze wurden aber immer hergestellt. Der Typ 4 zeigte in einem Fall auch eine vorm Brennprozeß eingefügte Kennzeichnung „F.C.E. 7“, die ich leider nicht auflösen und einem bestimmten Ort zuordnen konnte. Crienitz und Colditz kämen als weitere mögliche Herstellungsorte eventuell auch in Frage. Die Herstellung von Schornsteinaufsätzen in einem Meißner keramischen Betrieb (hier nicht die Manufaktur gemeint!) konnte mir durch das dortige Stadtmuseum nicht bestätigt werden.
Ausblick
Offenbar handelt es sich bei den keramischen Schornsteinaufsätzen um eine aussterbende Spezies, ganz grob vergleichbar mit Sauriern. Von den Aufsätzen muss es früher in Radebeul weit mehr auf unseren Dächern gegeben haben als ich 2021 mit Mühe noch finden konnte. In ein paar Fällen – Meißner Straße 289 und Neue Straße 12 – sehen die Eigentümer darin eine Besonderheit, die sie weiterhin erhalten möchten. Aber inzwischen gibt es modernere Heizsysteme, die andere Rauchableitungen haben. Insofern wird die Zahl dieser „Saurier“ wohl noch weiter abnehmen, was mir von den Fachleuten Herrn Schubert (Bezirksschornsteinfegemeister) und Herrn Zscherpe (Dachdeckermeister) – Dank dahin – so bestätigt wurde. Um die Frage aus der Überschrift aufzugreifen, ja, sie können weg, was mir schon etwas Leid täte. Da, wo ein privates Interesse am Erhalt dieser Relikte aus einer anderen Zeit besteht, werden wir sie noch eine Weile auf den Radebeuler Dächern sehen. Vielleicht wird sich aber die Zahl der Blumenschalen aus Steinzeug in den Vorgärten durch Abbau der Rohre von den Dächern noch vergrößern? Ich bedanke mich bei den Häusereigentümern, Frau Professor Pohlack, Herrn Doktor Krüger und Familie Kaltofen, die Verständnis für mein spezielles Interesse aufbrachten und mich näher an die Objekte herantreten ließen.
Dietrich Lohse