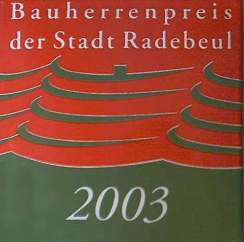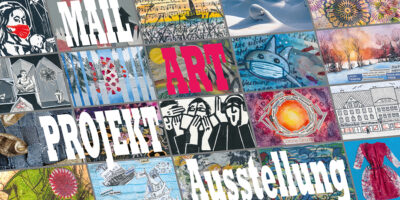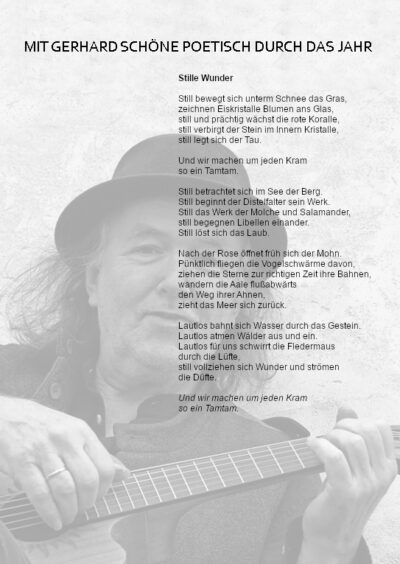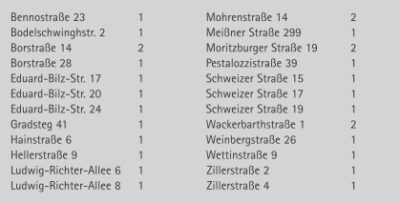Werte Leserinnen und Leser,
der Vorstand des Radebeuler Monatsheftes e.V. hat sich entschlossen, der Bitte des Radebeuler Kultur e.V. nachzukommen und dessen Offenen Brief in Sachen Serkowitzer Gasthof an den Oberbürgermeister Bert Wendsche und die Radebeuler Stadträte in unserem Monatsheft „Vorschau & Rückblick“ zu veröffentlichen.
Wir glauben, dass es sich bei dem ehemaligen Gasthof und dem Lügenmuseum um zwei für die Stadtgesellschaft bedeutende kulturelle Träger handelt, deren Zukunft uns nicht gleichgültig sein kann. Deshalb wollen wir mit zu einer möglichst allseitigen Information beitragen und die Suche nach einer vernünftigen Lösung für den Erhalt des Serkowitzer Gasthofes und den Verbleib des Lügenmuseums in Radebeul unterstützen.
Der Offene Brief wird mitgetragen von über 90 Erstunterzeichnern aus Politik, Kultur, Kunst und der Bürgergesellschaft von Radebeul und weiteren Orten der Bundesrepublik. Wer das Anliegen des Briefes unterstützen will, wende sich bitte an den Radebeuler Kultur e.V. Gern nimmt auch die Redaktion Zuschriften in dieser Angelegenheit entgegen.
Der Vorstand
Hinweise
Der Offene Brief kann beim Radebeuler Kultur e.V. unterzeichnet werden. Rückfragen sind ebenfalls an den Verein zu richten. Kontakt: Radebeuler Kultur e.V., 01445 Radebeul, Meißner Straße 21, info@radebeuler-kultur.de, www.radebeuler-kultur.de.
Informationen zum Lügenmuseum sind unter www.luegenmuseum.de, info@luegenmuseum.de, Tel.: 0176/99 02 56 52 erhältlich.
An den 
Oberbürgermeister
Bert Wendsche
und
die Mitglieder des Stadtrates Radebeul
Offener Brief des Radebeuler Kultur e.V.zur Situation des ehemaligen „Gasthof Serkowitz“ und des Lügenmuseums
Der unter Denkmalschutz stehende ehemalige „Gasthof Serkowitz“ in Radebeul fand bereits im Jahr 1337 eine erste urkundliche Erwähnung. Gut erhalten sind der Ballsaal sowie zwei Sgraffiti des Dresdner Künstlers Hermann Glöckner (1889–1987). Nach einer Zeit des Leerstandes erwarb die Stadt Radebeul das Gebäude im Jahr 2007 für 10.000 Euro aus einer Zwangsversteigerung und stellte dessen Räume 2012 dem Lügenmuseum zur Verfügung. Ein dauerhafter Erwerb oder gar eine Sanierung war nicht geplant.
Heute ist die Situation in der Stadt aber eine andere. Mit dem Lügenmuseum hat Radebeul eine kulturelle Attraktion erhalten, welche europaweit ausstrahlt. Es wird sowohl von Besuchern aus der Lößnitzstadt, als auch aus der näheren und ferneren Umgebung gern aufgesucht und gehört mit seinen verlässlichen Öffnungszeiten an den Wochenenden und während der Schulferien zu den bevorzugtesten Zielen in Radebeul, vor allem auch von jungen Familien. Die Homepage gibt Einblick in die vielfältigen Aktivitäten des Lügenmuseums und seiner Akteure. Für Touristen ist das Lügenmuseum ein bevorzugter Anziehungspunkt, wie aus Umfragen hervorgeht.
Das Lügenmuseum wurde und wird maßgeblich durch den Künstler Reinhard Zabka geprägt. Sein Frühwerk wurzelt in der einstigen DDR-Dissidentenszene. Nach dem gesellschaftlichen Umbruch fand Zabka auch internationale Anerkennung. So war er im Jahr 1990 mit der Installation „Labyrinth der Erinnerung“ auf der Biennale in Venedig vertreten.
Der kontakt- und experimentierfreudige Künstler zeigt seine Werke seit 1990 in einem eigens dafür geschaffenen Museum. Dessen Aufnahme in den Museumsverband Brandenburg erfolgte 1995. Der große Zuspruch erforderte eine räumliche Erweiterung. Ein ehemaliges Gutshaus in Gantikow wurde ab 1997 für das Lügenmuseum zum neuen Domizil. Im Jahr 2000 erkannte der brandenburgische Landesverband LAG-Soziokultur das Lügenmuseum als soziokulturelles Zentrum an. Um den Fortbestand des Museums auf eine breitere Basis zu stellen, wurde im Jahr 2008 der Verein „Kunst der Lüge“ gegründet. Die Schließung des Lügenmuseums und der Weggang des Künstlers Reinhard Zabka aus Gantikow wurden sehr bedauert.
Mit Reinhard Zabka ist ein international anerkannter Künstler nach Radebeul gekommen, dessen Kunstmuseum auf unterhaltsame Weise Gegenstände mit geschichtlichem Bezug oder des Alltags in neue Zusammenhänge stellt. Kinetische Objekte, Licht- und Klanginstallationen erfreuen aufgeschlossene Besucher jeden Alters und bringen sie zum Innehalten, Staunen, Nachdenken oder Träumen.
Von seinem Basislager „Lügenmuseum“ aus zieht er in die Welt und kehrt mit neuen Kontakten, Erkenntnissen und Inspirationen nach Deutschland zurück. Im Ergebnis entstehen dort wie hier intermediale Gemeinschaftsprojekte, wie zum Beispiel in Radebeul das alljährliche Labyrinth auf den Elbwiesen. Erwähnenswert ist auch das Engagement zum 700-jährigen Ortsjubiläum von Serkowitz oder zum kulturellen Neustart unter Pandemiebedingungen.
Die Förderung seiner Projekte durch renommierte Einrichtungen wie die der Kulturstiftung des Bundes sind ein Beleg für die hohe Wertschätzung, welche dem Schaffen von Reinhard Zabka entgegengebracht wird. Für sein Wirken als Objektkünstler und Kunstinitiator wurde Reinhard Zabka im Jahr 2016 der Radebeuler Kunstpreis verliehen. Im Jahr 2021 erfolgte die Aufnahme des Lügenmuseums in den Sächsischen Landesverband Soziokultur.
Die glückliche Symbiose zwischen einem kulturhistorisch bedeutsamen Baukörper und einem kreativ-schöpferischen Ort mit bundesweiter Ausstrahlung ist ein großer Gewinn für Radebeul. Mit dem Verkauf des Objektes würde diese Symbiose nicht nur zerstört, sondern der überregional anerkannte Künstler und Kunstpreisträger Reinhard Zabka regelrecht aus Radebeul vertrieben. Die historischen Räume wären dann in ihrer Ursprünglichkeit nicht mehr erlebbar, zumal der attraktive Ballsaal mit Bühne die einzige größere Räumlichkeit dieser Art ist, die sich noch im städtischen Besitz befindet.
Die Unterzeichner appellieren eindringlich an die Verantwortungsträger der Stadt, gemeinsam mit den unmittelbar Beteiligten und maßgeblichen Vertretern der kulturellen Szene nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen, mit dem Ziel, das historische Gebäude einschließlich Saal zu erhalten und dem Lügenmuseum eine dauerhafte Existenz in Radebeul zu ermöglichen. Die Potenziale des zwischen Elbradweg und Schmalspurbahn gelegenen Lügenmuseums sollten sinnvoll mit denen des Karl-May-Museums, des Weinbaumuseums und der Stadtgalerie verknüpft werden.
Wir bitten alle Bürger, durch ihre Unterschrift diesen „Offenen Brief“ und damit unser Anliegen zu unterstützen.
Günter Baby Sommer – Vorsitzender
Nora Sandner – Stellv. Vorsitzende
Katharina Sommer – Stellv. Vorsitzende
Anja Wenzel – Kassenwart
Björn Reinemer – Geschäftsführer
Radebeul, den 29. März 2022
Erstunterzeichner
Offener Brief des Radebeuler Kultur e.V.
zur Situation des ehemaligen „Gasthof Serkowitz“ und des Lügenmuseums
Prof. Ralf Kerbach, Maler, Grafiker, Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste – Prof. Dr. phil. (i. R.) Gerd Koch, Berlin – Peter Graf, Maler, Träger Radebeuler Kunstpreis, Radebeul – Jens Kuhbandner, Verleger, Träger Radebeuler Kunstpreis, Radebeul – Thomas Gerlach, Schriftsteller, Träger Radebeuler Kunstpreis, Radebeul – Prof. (em.) Detlef Reinemer, Bildhauer, Träger Radebeuler Kunstpreis, Radebeul – Uwe Wittig, Radebeuler Stadtrat, Radebeul – Uwe Proksch, Geschäftsführer Kulturfabrik Hoyerswerda – Karin Baum, Dipl. Kunstpädagogin, Kulturaktivistin i. D., Stadtgaleristin a. D., Radebeul – Prof. (em.) Annerose Schulze, Künstlerin, Radebeul – Fritz Peter Schulze, Bildhauer, Radebeul – Prof. Bernd Guhr, Theaterwissenschaftler, Dozent, Schauspielpädagoge, Leipzig – Dr. Sandra Wirth, Politikwissenschaftlerin, Vizepräsidentin des Bundes Deutscher Amateurtheater, Präsidiumsmitglied des Deutschen Musikrates, Leipzig – Gabriele Reinemer, Dipl. Bildhauerin, Radebeul – Dr. Tobias J. Knoblich, Dezernent für Kultur und Stadtentwicklung der Landeshauptstadt Erfurt, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V., Mitglied im Kulturausschuss des Deutschen Städtetags (Erfurt) – Wolf-Dieter Gööck, Sänger, Schauspieler, Regisseur, Radebeul – Torsten Tannenberg, Geschäftsführer des Sächsischen Musikrates e. V., Dresden – Barbara Plänitz, Dipl. Sozialpädagogin, Radebeul – Ilona Rau, Vorsitzende „Vorschau und Rückblick“, Coswig – Dr. Bertram Kazmirowski, Lehrer, Vorstandsmitglied „Vorschau & Rückblick“, Dresden – Sascha Graedtke M.A., Chefredakteur „Vorschau und Rückblick“, Radebeul – Sigrid Herrmann, Kosmetikerin, Radebeul – Andreas Herrmann, Techniker, Radebeul – Dirk Strobel, Dramaturg, Regisseur, Theaterpädagoge, Dresden – Karen Graf, Malerin, Radebeul – Karola Smy, Malerin, Grafikerin, Kreischa – Wolfgang Smy, Maler, Grafiker, Kreischa – Matthias Kratschmer, Industriedesigner, Radebeul – Karl Uwe Baum, Präsidiumsmitglied des BDAT, Radebeul – Irene Wieland, Freischaffende Künstlerin Grafik und Skulptur, Radebeul – Larsen Sechert, Theaterwissenschaftler, Regisseur, Clown, Leipzig – Thomas Teubert, Inhaber Weinkeller Am Goldenen Wagen, Radebeul – Petra Schade, Malerin, Grafikerin, Fotografin, Radeburg – Burkhard Schade, Fotograf, Radeburg – Roland Friedel, Schauspieler, Rundfunksprecher a. D., Leipzig – Gudrun Postl, Kosmetikerin, Radebeul – Klaus Liebscher, Maler, Restaurator, Radebeul – Antje Herrmann, Kommunikationsdesignerin, Dresden-Cossebaude – Maxi Baum, Erzieherin, Dresden – Gisela Streufert, Lektorin, Radebeul – Ute Hartwig-Schulz, Bildhauerin, Künstlergut Prösitz, Grimma, OT Prösitz – Michael Linke, Regisseur, Schauspieler, Musiker, Bautzen – Tim Schreiber, Pantomime, Dresden – Jan Oelker, Fotograf, Radebeul – Iduna Böhning-Riedel, Geschäftsführerin Kunsthaus Raskolnikow e. V., Dresden – Dorothee Kuhbandner, Malerin, Grafikerin, Inhaberin Galerie mit Weitblick, Radebeul – Sylvia Fenk, Bühnen- und Kostümbildnerin, Meißen – Christina Koenig, Dipl. Kommunikationswirtin, Autorin, Keramikerin, Meißen – Manuel Frolik, Künstler, Dresden – Kornelia Lindner, Buchbindermeisterin, Radebeul – Johannes Lindner, Dipl.- Restaurator, Radebeul – Bettina Zimmermann, Freischaffende Künstlerin Malerei, Zeichnung, Objekte, Klipphausen – Michael Heuser, Schauspieler, Radebeul – Michaela Mayer, Sachkundige Bürgerin, Fraktion „Bürger für Meißen“/SPD, Meißen – Birgit Freund, Vorsitzende Fremdenverkehrsverein Radebeul e. V. – Michael Freund, Bürger, Radebeul – Sophie Cau, Malerin, Radebeul – A. Leliveld, Unternehmer, Radebeul – Katrin Leliveld, Unternehmerin, Radebeul – Gisbert Uthoff, Angestellter, Radebeul – Ulrike Kunze, Bühnen- und Kostümbildnerin, Radebeul – Lydia Hempel, Geschäftsführerin Landesverband Bildende Kunst Sachsen e.V., Dresden – Stefan Voigt, Künstler, Radebeul – Gudrun Brückel, Künstlerin, Dresden – Christiane Latendorf, Dipl. Malerin Grafikerin, Dresden – Cornelia Konheiser, Künstlerin Malerei, Grafik, Radebeul – Michael Lange, Fotograf, Quohren – Bärbel Voigt, Malerin, Grafikerin, Radebeul – Gabriele Seitz, Fotografin, Radebeul – Klaus Brendler, Dipl.-Pädagoge, Vorsitzender des Vereins Dresdner Geschichtsmarkt, Dresden – Gudrun Trendafilov, Künstlerin, Dresden – Christine Fuchs, Bürgerin, Radebeul – Maja Nagel, Filmemacherin, Malerin, Grafikerin, Nossen/Eula – Biliana Vardjieva-Winkler, Künstlerin, Dresden – Daniel Bahrmann, Fotograf, Meißen – Karen Roßki, Malerin, Dresden – Birgit Schaffer, Ingenieurin, Dresden – Marion Arnold, Laborantin, Käbschütztal, OT Canitz – Uwe Arnold, Informatiker, Käbschütztal, OT Canitz – Gerald Leuschner, Werkschutzkraft, Moritzburg, OT Friedewald – Regine Wollmerstädt, Bürgerin, Radebeul – Bodo Pietsch, Forstingenieur, Jäger, Radebeul – Heidi Pietsch, Dipl. Ingenieurin Arbeitswissenschaft, Radebeul – Christian Martins, Verkäufer, Radebeul – Margret Plänitz, Schneiderin, Radebeul – Stefan Hoth, Teamleiter, Radebeul – Carmen Grüdl, Angestellte, Radebeul – Phillip Grüdl, Angestellter, Radebeul – Christian Plänitz, Rentner, Radebeul – Sandra von Holn, Regisseurin, Schauspielerin, Sängerin, Leipzig – Ingrid Fiedler, Verwaltungsangestellte, Radebeul – Dieter Hoffmann, Klempner, Radebeul – Regina Richter, Rentnerin, Radebeul – Rainer Richter, Restaurator, Radebeul – Annett Müller, Verkäuferin, Radebeul – Daniel Nicolaus, Dipl. Sänger, Radebeul – Bettina Löschner, Teilkonstrukteurin, Radebeul – Dr. Klaus Löschner, Architekt, Radebeul – Frank Andert, Museumsleiter, Radebeul.