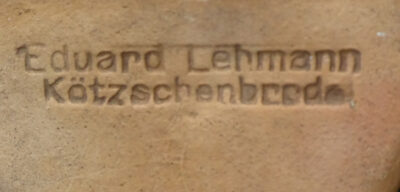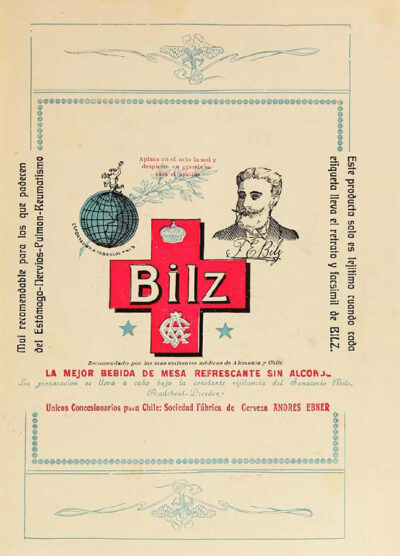1623 – 2023: 400 Jahre Haus Möbius
X
Haus und Giebel
Die Sachlage zur Dachfrage
Die Langeweile unserer modernen Städte …
nein, ruft Ulrike entsetzt dazwischen, nicht, hör auf!
… kommt nicht zuletzt daher, dass es keinerlei Überraschungen mehr gibt. Alles sieht gleich aus, die Landschaft wird der Bauweise angepasst und nicht umgedreht. Die künstliche Intelligenz der Stadtplaner und Architekten kennt weder menschliche Maßstäbe noch Abwechslungen oder gar Besonderheiten. Wo es nur rechte Winkel gibt, kann nichts Rechtes rauskommen.
Aber, wendet Ulrike berechtigt ein, rechte Winkel sind doch wichtig für die Stabilität.
Schon, schon, ereifere ich mich, aber ein Haus braucht mehr als rechte Winkel – wenn das Grundgerüst stabil ist, brauchts Raum für Besonderheiten; und anders als die Schönheit, liegen die nicht im Auge des Betrachters. Sie sind vielmehr ohne Sehhilfe wahrnehm- und manchmal sogar meßbar. Die Empfindungen, die sie hervorrufen, sind dann freilich wieder mit den schönen Augen der Betrachterin verbunden… Auf die Stabilität jedenfalls, sage ich nach einem kräftigen Schluck aus dem Glase, wirken sie sich nicht aus, wenigstens nicht negativ. Du siehst ja, unser Haus mit all seinem rechten und unrechten Gewinkel steht seit 400 Jahren, und das ist jedenfalls kein Zufall. Das müssen uns die anderen erst mal nachmachen…
Aber sag mal, kürzt Ulrike die Diskussion glücklich ab, wie kommst du denn jetzt darauf?
Na ja, ich werd halt immer wieder mal nach unsrem „schiefen“ Giebel gefragt, vor allem, seit ich im letzten Heft den Anblick von Osten her so hervorgehoben habe.
Dabei muß ich feststellen, daß der gar nicht so einfach zu erklären ist.
Klar ist, das Haus wurde erweitert.
Aber wann und wie?
Es deutet alles darauf hin, daß die massiven Umfassungsmauern für das Untergeschoß gleich beim ersten Anbau, also um 1715, in heutigen Maßen errichtet wurden und wohl das einstige Pressenhaus mit einbezogen. Jedenfalls sind die Deckenbalken bis heute durchgehend erhalten.
Das Obergeschoß wurde in den Ausmaßen allerdings an das alte Haus angepaßt, so daß an der Nordseite ein Laubengang entstand, wie es ihn in vergleichbaren Häusern öfter gab.
Ach, entfährt es Ulrike, das war ja romantisch!
Wenn du so willst, ja, bestätige ich. Von Westen her führte eine überdachte Treppe auf den Gang und die neuen Räume waren von außen her begehbar.
Vielleicht wohnte nun der Winzer im alten Haus und die Herrschaft dann und wann im Neuen, wer weiß …
Vielleich war der Laubengang von Anfang an unterm Schleppdach geborgen, vielleicht wurde das auch später angefügt, als die Laube geschlossen und ins Haus einbezogen wurde, wer weiß …
Spätestens 1784 ist dann die farbliche Gestaltung des Fachwerkes anzusetzen, dieses schöne Ziegelrot, unter dem noch Spuren einer älteren, dunklen Balkenfassung beobachtet wurden. Es müssen fröhliche Jahre gewesen sein, damals…
Das ist ja das Schöne an den alten Häusern, daß sie nicht nur schöne Augen noch schöner machen, sondern Raum geben zum Träumen. Stell dir vor, wir säßen jetzt in der Laube, über uns hingen Lavendelbündel zum Trocknen und verströmten ihren Duft, vielleicht kämen noch Sonnenblumenköpfe dazu, die für die Vögel im Winter bereitgehalten werden. Und wenn jemand die Treppe hochgepoltert käme, wäre ein Glas da und ein Stuhl…
Aber so ist es nicht mehr. Vielleicht sieht es auf dem Bild von Michael Hofmann deshalb so aus, als stünde der Tisch mit dem Wein auf der Straße …
Thomas Gerlach
(Für die Reproduktion und die Druckerlaubnis danke ich Familie Kronbach sehr herzlich.)