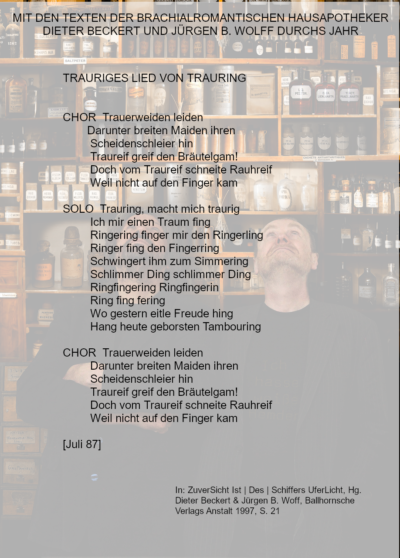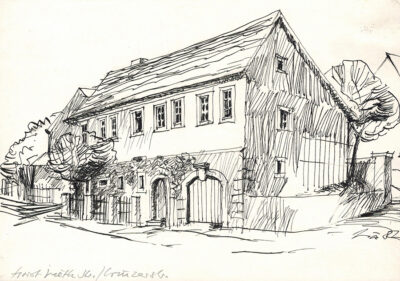Oder ein Plädoyer für Kunst und Künstler, diesmal in einfacher Sprache

Die meisten Besucher kommen per Fahrrad ins Lügenmuseum, 2023, Foto: Karin (Gerhardt) Baum
Bereits zum dritten Mal wurde der historische Gasthof Serkowitz in kurzer Folge von der Großen Kreisstadt Radebeul zum Verkauf ausgeschrieben. Das darin befindliche Museum mit dem kreativen Künstlerteam und den vielen außergewöhnlichen Exponaten spielt im Ausschreibungstext keine Rolle. Man scheint darauf verzichten zu können, ohne genau zu wissen, was man damit verliert. Stattdessen wird „eine öffentliche Nutzung, vorzugsweise als Gaststätte mit angegliedertem Saal“ bevorzugt. Dass dann endlich Ruhe in Altserkkowitz einzieht, darf allerdings bezweifelt werden, denn eine Gastwirtschaft mit Saal muss sich rechnen. Statt der Museumsbesucher, die heute überwiegend mit dem Fahrrad kommen, werden die Gäste dann wohl hauptsächlich mit PKWs und Bussen anreisen.
Eindeutig auf der monetären Gewinnerseite befindet sich die Radebeuler Stadtverwaltung. Sie macht mit der Transaktion keinen Verlust. Das Objekt wurde für 10.000 Euro ersteigert. Verkauft werden soll es nun für 310.000 Euro. Wenn man alle Ausgaben für bisherige Sanierungsarbeiten und sonstige Maßnahmen abzieht, bleibt immer noch ein stattliches Sümmchen übrig, um es in den städtischen Haushalt einfließen zu lassen. Aus Sicht der Steuerzahler hat der „Konzern Stadt“ sehr klever gehandelt. Respekt!
Auf der Gewinnerseite befindet sich die Radebeuler Stadtverwaltung auch noch aus einem anderen Grund. Seit 2012 schmückt sie sich mit dem überregional bekannten Kunstmuseum, obwohl dieses ja angeblich gar kein richtiges Museum ist und mit seiner „Ansammlung von Flohmarkt-Exponaten“ das Image der Lößnitzstadt als Premiummarke vor den Toren der Kulturstadt Dresden (laut einem Gutachten) beschädigen könnte.
Unbeeindruckt von dieser Verächtlichmachung hält das Lügenmuseum regelmäßige Öffnungszeiten vor, ohne die Stadtverwaltung mit Personalkosten zu belasten. Geöffnet ist diese Kultureinrichtung seit 2012 zuverlässig jeden Samstag und Sonntag sowie während der Schulferien und an den Feiertagen von 13 bis 18 Uhr. Was nicht nur mich empört ist, dass die Leistungen des Kunstpreisträgers Reinhard Zabka und all seiner motivierten Mitstreiter eine unbeschreibliche Geringschätzung erfahren.
Als ehemalige Stadtgaleristin habe ich mich immer als eine Art Dolmetscherin verstanden, zwischen den produzierenden Künstlern und den konsumierenden Kunstbetrachtern. Missverständnisse inklusive! Das Lügenmuseum provoziert und polarisiert. Nicht jeder findet das lustig. Andererseits habe ich in Besucherbüchern selten so geistreiche Eintragungen gelesen. Einen Grund muss es doch geben, dass es so viele Menschen drängt, ihre Gedanken und Empfindungen zu beschreiben. Und das nicht nur im Besucherbuch! Andererseits scheint es auch Gründe zu geben, dass der Verbleib des Lügenmuseums im Gasthof Serkowiztz selbst nach zehnjährigem Museumsbetrieb einigen Menschen bis heute ein Dorn im Auge ist.
Meine Arbeitsbeziehung zu Reinhard Zabka alias Richard von Gigantikow begann im Jahr 2009. In Vorbereitung der Ausstellung „Der Schein des Seins“ war ich im Gutshaus Gantikow bei Kyritz an der Knatter, wo sich seit 1997 das von ihm gegründete Lügenmuseum befand. Vor Ort wählten wir einige Exponate von Zabka aus, welche in der Radebeuler Stadtgalerie gezeigt werden sollten. Das Museum mit dem seltsamen Namen hatte mich in seiner künstlerischen Komplexität stark beeindruckt und meine Erwartungen bei Weitem übertroffen. Durch das seit 1999 zum Herbst- und Weinfest errichtete Labyrinth war mir der Künstler Reinhard Zabka bereits ein Begriff. Als es dann hieß, das Lügenmuseum zieht nach Radebeul, konnte ich es kaum fassen.

Originelles Wegweisersystem aus Abfallhölzern vorm Lügenmuseum, 2023, Foto: Karin (Gerhardt) Baum

Das begehbare Labyrinth auf den Elbwiesen, 2012, Foto: Karin (Gerhardt) Baum
Dass ich einmal in der 42-teiligen „Tatort Radebeul“ Serie als „Kulturleiche“ ende, war damals noch nicht abzusehen. Freud und Leid liegen eben dicht beieinander! Auch für den brandenburgische Museumsverband, der immer stolz auf „sein“ Lügenmuseum gewesen ist, wie Susanne Köstering 2014 in ihrer Laudatio zur Verleihung des Kunstpreises an Reinhard Zabka bekannte, war der Wegzug ein kultureller Verlust.
Innerhalb der Radebeuler Künstlerschaft gehen die Meinungen zum Lügenmuseum weit auseinander, so wie ja auch die jeweiligen Künstler sehr verschieden sind. Zu den bekennenden Team-Akteuren, die an verschiedenen Projekten unter der künstlerischen Leitung von Zabka immer wieder aktiv mitwirken, gehört der 82jährige Freigeist, Restaurator, Performer, Maler, Grafiker, Objektbauer, Literatur-, Film- und Jazzkenner Klaus Liebscher. Allerdings haben sich auch andere Radebeuler Künstler wie Sophie Cau, Cornelia Konheiser, Jan Oelker, André Wirsig, Dorothee Kuhbandner, André Uhlig, Günter „Baby“ Sommer oder Thomas Gerlach bereits mehrfach an verschiedenen Projekten und Aktionen beteiligt. Die vielen anderen, auch internationalen Künstler seien hier aus Platzgründen nicht genannt.
Die erneute Aussschreibung des Gasthofes Serkowitz im August 2023, bot den aktuellen Anlass, um Sinn und Nutzen des Lügenmuseums noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Aber wo anfangen?
Im ehemaligen Serkowitzer Gasthof befinden sich nicht nur die Exponate des Lügenmuseums. Hier wird geplant, gefachsimpelt, getüftelt und produziert. Hier befindet sich das Basislager, von dem Kontakte zu Künstlern in aller Welt geknüpft und in kurzen Abständen immer wieder neue kreative Signale ausgesendet werden. Allerdings fällt es nicht immer leicht, der schnellen Taktung zu folgen. Auch die Homepage ist eine große Herausforderung mit ihren ständig wechselnden Texten, Fotografien und Filmen.
Es gibt in Radebeul keinen zweiten Kunstort, der so experimentierfreudig, gegenwartsbezogen, philosophisch, gesellschaftskritisch und weltoffen ist! Für Künstler und Bürger bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zur kreativen Mitwirkung. Sei es an themenorientierten Projekten, Workshops, Gesprächsrunden oder verschiedenen Festivitäten.

Veranika Chykalava, Belarus, »Maya« (Kuh), Henkelkunst, Mischtechnik, 2023, Foto: Karin (Gerhardt) Baum

Getúlio Damado, Brasilien, »Lauraalicy«, Figur, Mischtechnik, 2017, Foto: Karin (Gerhardt) Baum

Komatsu Tsunetaka, Japan, »Das niedrigste Storchennest Deutschlands«, Objekt, 1995, Foto: Karin (Gerhardt) Baum
Projekte wie „Funken schlagen“ oder „Kunstbrücke“ dienten der Vernetzung von Kunst- und Kulturschaffenden dies- und jenseits der Elbe. Dabei ging es u. a. um die öffentliche Wahrnehmung unterschiedlicher Kunstorte sowie um die Belebung leerstehender Gebäude. Zu den offenen Diskussionsrunden waren Gemeindevertreter, Projektentwickler, Innenstadtmanager, Touristiker, Kulturarbeiter, Museumsleiter, Galeristen, Künstler, Politiker und Interessierte eingeladen.
Selbst in der schwierigen Corona Zeit herrschte vor und hinter den Kulissen des Lügenmuseums kein Stillstand. So wurde das „Museum to go“ erfunden, die „Fassadengalerie“ eröffnet und auf dem Dorfanger von Serkowitz mit Künstlern und Anwohnern die „Offene Kunsthalle“ initiiert.
Erst kürzlich fanden einige Workshops zur Produktentwicklung aus Recyclingmaterialien statt. Entstanden sind u.a. Kunstwerke mit Henkel, die man wie eine Gucci-Tasche ausführen kann, bizarre Leuchtobjekte und originelle Ohranhänger. Erwerben kann man die Unikate im neu entstandenen Museumsshop.
Während das Lügenmuseum für viele Künstler ein Produktionsort ist, können sich die Museumsbesucher in eine Welt der Träume, Kindheitserinnerungen und Absurditäten begeben.
Hier werden alle Sinne gleichzeitig angesprochen. Die Kunstwerke bewegen sich, klappern oder blinken. Film-, Bild- und Tondokumente werden raffiniert (gewollt beiläufig) präsentiert. Den roten Faden muss jeder selber finden. Die einstige Museumsgründerin Emma von Hohenbüssow, kann keine museumspädagogische Hilfestellung mehr leisten. Ihr legitimer Nachfolger Richard von Gigantikow trägt leider auch nur wenig zur Aufklärung bei und stiftet eher noch mehr Verwirrung, indem er Lüge und Wahrheit geschickt vermengt. Trotzdem sollte man sich den Lügentee und seine fantasievollen Geschichten nicht entgehen lassen, sind sie doch ein Bestandteil des Gesamtkunstwerkes „Lügenmuseum“. Eigenständige Entdeckungstouren sind beim nächsten und übernächsten Museumsbesuch empfehlens- und lohnenswert.

Die (späteren) Radebeuler Kunstpreisträger Helmut Raeder und Reinhard Zabka im Gespräch, 2005 Foto: Karin (Gerhardt) Baum

Die Künstlerinnen Dorota Zabka und Veranika Chykalava, 2023, Foto: Karin (Gerhardt) Baum
Wenngleich Reinhard Zabka alias Richard von Gigantikow Erfinder, Leiter, Kurator und mediales Aushängeschild des Lügenmuseums ist, werden sowohl das Museum als auch die vielen Projekte von Künstlern aus aller Welt geprägt. Die Exponate der thematischen Rauminszenierungen stammen von bekannten und völlig unbekannten Künstlern aus Deutschland, Polen, Chile, England, Thailand, China, Burma, Indonesien, Japan, Italien, Marokko, Mali, Frankreich, Bulgarien, Holland, Persien…
Einen interessanten Ausstellungsschwerpunkt bildet die Rauminszenierung „Interieur Underground“. Sie gibt Einblick in die Boheme und Subkultur der späten DDR. Zu sehen sind im konspirativen Ambiente zahlreiche Werke rand- und widerständiger Künstler, die sich eigener Codes und künstlerischer Mittel bedienten, darunter Arbeiten von Cornelia Schleime, Harald Hauswald, Lutz Fleischer, Gabriele Stötzer, Jürgen Gottschalk, Ellen Steger, Günter Starke… und natürlich auch Reinhard Zabka.
In Vorbereitung einer speziellen Museumsführung zur „Langen Nacht der Frauen“ arbeitete ich erstmals mit Dorota Zabka (44) und Veranika Chykalava (41) zusammen. Meine Neugier war geweckt und ich wollte mehr über die beiden Frauen erfahren.
Dorota Zabka wurde in Polen geboren und lebt seit über zwanzig Jahren in Deutschland. Sie ist die Vorsitzende des Vereins „Kunst der Lüge“ e.V.. Der 2008 in Kyritz gegründete Verein fördert Kunst, Kultur und Denkmalpflege, im Besonderen das Lügenmuseum als Gesamtkunstwerk, den Dialog der Kulturen, internationale Kunstprojekte und soziokulturelle Aktivitäten. Dorota gehört zum engeren Team des Lügenmuseums. Sie ist zuständig für die Beantragung von Fördermitteln, die Organisation von Projekten und die Betreuung der Webseite, wirkt künstlerisch-gestalterisch mit, hilft bei Sanierungsarbeiten und Kleinstreparaturen. Sie ist davon überzeugt, „dass das Lügenmuseum sehr viel Potenzial hat und sich mit einer klugen Strategie zu einem wichtigen Anziehungspunkt der Umgebung oder sogar Sachsens entwickeln kann“. Denn die Lage ist optimal: Elbradweg, Achse Dresden-Meißen, Kooperationsmöglichkeiten mit nahegelegenen Kultureinrichtungen.
Veranika Chykalava stammt aus Belarus, hat ursprünglich Upcycling-Schmuck hergestellt und ist als autodidaktische Fotografin tätig. Seit 2022 absolviert sie im Lügenmuseum ihren Bundesfreiwilligendienst. Als sie hier ankam, war sie „erst einmal entsetzt und irritiert, weil“ sie „so etwas Einzigartiges und Skurriles noch nie im Leben gesehen hatte und zunächst nicht alles erfassen konnte“. Mit der Zeit wurde sie offener und wissbegieriger, denn das Museum wäre „der beste Lehrer“. Früher war sie eher „eine Einzelgängerin, was ihr allerdings nicht wirklich dabei geholfen habe, ihre Ziele zu erreichen und auch glücklich zu sein“. Sie liebt es, „mit anderen Künstlern und kreativen Menschen an interessanten Projekten zu arbeiten, sich auszutauschen und somit gegenseitig zu bereichern“. Im Lügenmuseum ist sie zuständig für Museumsdienste, Führungen und die Kommunikation mit den Besuchern sowie für die Bezeichnung, Inventarisierung und Dokumentation der Museumsobjekte. Sie hilft mit bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.

Szene aus »Tatort Radebeul« mit Kulturleiche im Keller des Lügenmuseums, 2022, Foto: Karin (Gerhardt) Baum
Beide wünschen sich, dass die Radebeuler Entscheidungsträger die zukunftsweisende Qualität des Lügenmuseums erkennen und diesen Ort gemeinsam mit den Akteuren weiterentwickeln. Vor allem aber wünschen sie sich, dass die Unsicherheit bald ein gutes Ende findet.
Auf Dorota, Veranika, Reinhard und all die anderen warten in den nächsten Wochen „viel Arbeit aber auch eine Menge Spaß“. Denn schon bald werden die Besucher des Herbst- und Weinfestes auf den Elbwiesen durch das temporäre Skulpturenlabyrinth aus Paletten und Abfallholz wandeln, um es schließlich zum feurigen Finale in Flammen aufgehen zu sehen. Hoffen wir, dass uns das Lügenmuseum in Radebeul noch etwas länger erhalten bleibt. Denn Inspiration und Freude strahlen aus auf unser aller Leben.
Karin (Gerhardt) Baum