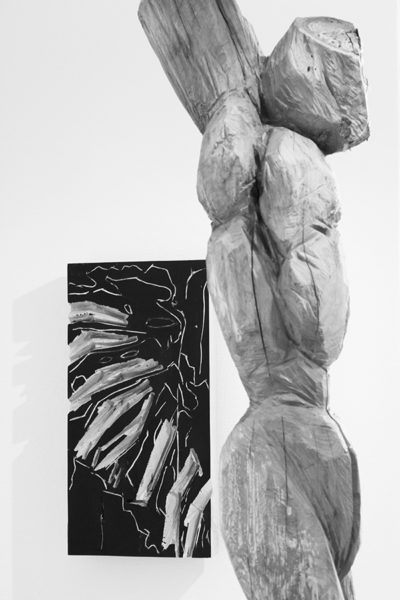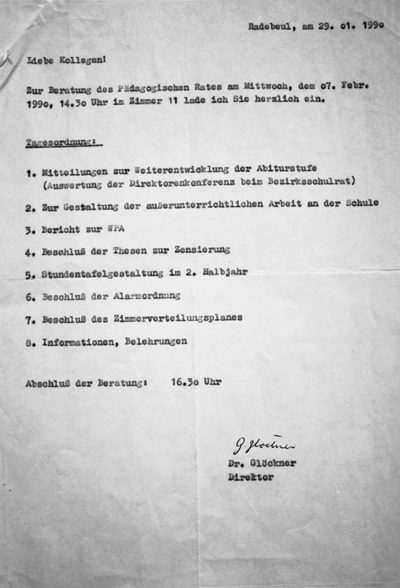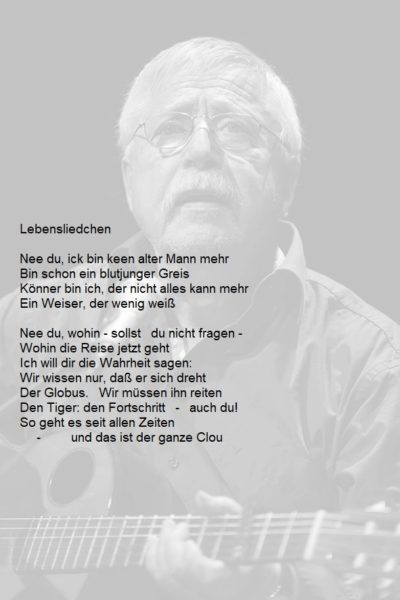Um es gleich klar zu stellen, es sind nicht die Häuser gemeint, wo politische Parteien ihren Sitz hatten oder haben, die die Farbe Rot zu ihrem Logo auserkoren haben. Vielmehr will ich mich heute Gebäuden nähern mit roten und manchmal auch gelben Fassaden. In Radebeul dominieren, erkennbar an den Bauern-, Winzer- und Siedlungshäusern, bekanntlich verputzte Fassaden. Darunter mögen wohl auch ein paar inzwischen rot gestrichen worden sein, diese Häuser will ich hier aber nicht betrachten. Aber welche roten Häuser würden dann noch für meine Beschreibung übrig bleiben?
Um es gleich klar zu stellen, es sind nicht die Häuser gemeint, wo politische Parteien ihren Sitz hatten oder haben, die die Farbe Rot zu ihrem Logo auserkoren haben. Vielmehr will ich mich heute Gebäuden nähern mit roten und manchmal auch gelben Fassaden. In Radebeul dominieren, erkennbar an den Bauern-, Winzer- und Siedlungshäusern, bekanntlich verputzte Fassaden. Darunter mögen wohl auch ein paar inzwischen rot gestrichen worden sein, diese Häuser will ich hier aber nicht betrachten. Aber welche roten Häuser würden dann noch für meine Beschreibung übrig bleiben?
Ich möchte als heutiges Thema über Häuser mit Backsteinfassaden, oder dem Backstein in der optischen Wirkung ähnlichen  Ziegeln nachdenken und berichten. Klinkersteine und Backsteinziegel stellen das gleiche Baumaterial dar, sind gebrannte Tonziegel, deren unterschiedliche Namen regional bedingt sind. Gegenüber dem gewöhnlichen Mauerziegel ist Klinker das hochwertigere Material, hat allseitig eine kräftigere Farbe (gelblich, rot bis rotbraun) und ist witterungsbeständiger als Mauerziegel. Er wird im normalen Ziegelformat, sogenanntes Reichsformat (250x120x65 mm) hergestellt und als Fassade im Verband verbaut. Durch die Backsteingotik haben diese Ziegel vor allem im Norden Deutschlands schon eine lange Tradition.
Ziegeln nachdenken und berichten. Klinkersteine und Backsteinziegel stellen das gleiche Baumaterial dar, sind gebrannte Tonziegel, deren unterschiedliche Namen regional bedingt sind. Gegenüber dem gewöhnlichen Mauerziegel ist Klinker das hochwertigere Material, hat allseitig eine kräftigere Farbe (gelblich, rot bis rotbraun) und ist witterungsbeständiger als Mauerziegel. Er wird im normalen Ziegelformat, sogenanntes Reichsformat (250x120x65 mm) hergestellt und als Fassade im Verband verbaut. Durch die Backsteingotik haben diese Ziegel vor allem im Norden Deutschlands schon eine lange Tradition.
In der Gründerzeit, genauer gesagt als Teil dieser Bauepoche, wurden dann Verblendziegel entwickelt, um das Verputzen zu sparen, um die Bauwerke zu schmücken und farblich hervorzuheben und um die Baupflegekosten gering zu halten. Man könnte diese Mode salopp als den „kleineren Bruder“ des Klinkers bezeichnen, denn sie sind meist kleinformatigere Tonziegel (Ansicht 120×67 mm) mit Langlöchern und haben eine eingefärbte oder engobierte Front (rot oder gelb, seltener weiß, bzw. hellgrau). Der Name Verblendziegel kommt daher, dass die statisch erforderliche Außenwand aus Mauerziegeln (in der Regel 240 oder 360 mm dick) außen eine Schicht von farbigen Verblendziegeln vorgeblendet bekam. Insgesamt sind in Radebeul Fassaden mit Verblendziegeln häufiger anzutreffen als Häuserfronten mit echten Klinkern. Die beschriebenen farbigen Ziegelfassaden können auch in Kombination mit anderen Materialen beobachtet werden, z.B. mit Putzflächen im EG und Verblendziegeln im OG, Kombinationen mit Naturstein (hier meist der heimische Syenit) als Sockel oder Tür- und Fenstergewände aus Sandstein neben Verblendziegeln, vorwiegend verputzte Wandflächen mit Ecklisenen aus Verblendziegeln oder manchmal auch geometrische Muster z.B aus roten Verblendern in einer Fläche aus gelben  Verblendziegeln. Die meisten dieser Häuser sind mit Schieferdächern abgeschlossen, was einen stärkeren Kontrast ergibt als bei Ziegeldächern. Beim näheren Betrachten fällt auf, dass Verblendziegelfassaden meist nicht den klassischen Mauerverband „Läufer – Binder“ im Wechsel zeigen, sondern ganze Wände nur „Köpfe“ also nur Binder haben. Das lässt uns erkennen, dass diese Gründerzeitfassaden reine Schmuckformen sind und nicht der Statik und den klassischen Regeln des Maurerhandwerks entsprechen.
Verblendziegeln. Die meisten dieser Häuser sind mit Schieferdächern abgeschlossen, was einen stärkeren Kontrast ergibt als bei Ziegeldächern. Beim näheren Betrachten fällt auf, dass Verblendziegelfassaden meist nicht den klassischen Mauerverband „Läufer – Binder“ im Wechsel zeigen, sondern ganze Wände nur „Köpfe“ also nur Binder haben. Das lässt uns erkennen, dass diese Gründerzeitfassaden reine Schmuckformen sind und nicht der Statik und den klassischen Regeln des Maurerhandwerks entsprechen.
Obwohl rote und gelbe Fassaden in ganz Radebeul relativ selten sind, fällt auf, dass ein paar wichtigere Gebäude darunter zu finden sind: so, beim Rathaus Niederlößnitz (Arch. A. Neumann, 1892-95), bei den Bahnhöfen Radebeul Ost und Kötzschenbroda, bei der älteren Friedhofskapelle Radebeul Ost (Schilling & Graebner, 1890) und bei der wahrscheinlich größten Villa Radebeuls, der Kolbevilla in der Zinzendorfstraße (Arch. O. March, 1890 / 91).  Vielleicht bekommt Letztere vom Volksmund bald den Namen „Villa Sorgenvoll“ (zum Unterschied zum „Haus Sorgenfrei“ im Augustusweg) verpasst, weil hier seit Jahren der Verfall fortschreitet und kein Sanierungsfortschritt zu erkennen ist. Zur Gruppe der Wohn- und Geschäftshäuser, Villen und Mietvillen um 1880 – 1900 gehören u.a: das Wettinhaus (Deutsche Bank) Moritzburger Straße 1, Karlstraße 5, Bahnhofstraße 8/8a, „Villa Marie“, Dr.-Rudolf-Friedrichs-Str. 17, Clara-Zetkin-Str. 20 u. 22, Wichernstraße 6b, Meißner Straße 47 (Teekanne), die beiden kleinen Eisenbahnerhäuser in der Wasastraße hinter der Brücke (das waren mal Schrankenwärterhäuser, ehe die Bahnstrecke hoch gelegt wurde) sowie der stattliche Pavillon in der Pestalozzistraße gegenüber dem Rathaus. Und es gäbe durchaus noch ein paar weitere Häuser mit Verblendziegelfassaden, die jedoch den Rahmen dieses Berichts sprengen würden. An zwei Stellen in Radebeul kann man eine Konzentration derartiger Bauten wahrnehmen – im Raum Louisenstraße/ Albertplatz
Vielleicht bekommt Letztere vom Volksmund bald den Namen „Villa Sorgenvoll“ (zum Unterschied zum „Haus Sorgenfrei“ im Augustusweg) verpasst, weil hier seit Jahren der Verfall fortschreitet und kein Sanierungsfortschritt zu erkennen ist. Zur Gruppe der Wohn- und Geschäftshäuser, Villen und Mietvillen um 1880 – 1900 gehören u.a: das Wettinhaus (Deutsche Bank) Moritzburger Straße 1, Karlstraße 5, Bahnhofstraße 8/8a, „Villa Marie“, Dr.-Rudolf-Friedrichs-Str. 17, Clara-Zetkin-Str. 20 u. 22, Wichernstraße 6b, Meißner Straße 47 (Teekanne), die beiden kleinen Eisenbahnerhäuser in der Wasastraße hinter der Brücke (das waren mal Schrankenwärterhäuser, ehe die Bahnstrecke hoch gelegt wurde) sowie der stattliche Pavillon in der Pestalozzistraße gegenüber dem Rathaus. Und es gäbe durchaus noch ein paar weitere Häuser mit Verblendziegelfassaden, die jedoch den Rahmen dieses Berichts sprengen würden. An zwei Stellen in Radebeul kann man eine Konzentration derartiger Bauten wahrnehmen – im Raum Louisenstraße/ Albertplatz
und im Straßenzug Bahnhofstraße/ Moritzburger Straße. In den Fällen der Bahnhofstraße 8, 8a grenzen ein gelbliches und ein rötliches Haus aneinander und bei der Pestalozzistraße 16 und Schildenstraße 17 stehen sich jeweils ein gelbliches und ein rötliches Haus diagonal gegenüber. Meines Erachtens geht von diesen Häusern vor allem, wenn sie konzentriert stehen, ein stärkerer städtischer Charakter aus als sonst in Radebeul. Zunächst mögen sie hier als Fremdkörper wahrgenommen worden sein, doch wir haben uns längst an diese roten und farbigen Häuser im charakteristischen Häusermix von Radebeul gewöhnt.
Da wirft sich mir gerade noch eine Frage auf: warum wurden deutschlandweit, also über Radebeul hinaus, für Fassaden von Bahnhöfen, Stellwerken, Betriebsgebäuden und auch Dienstwohnungen der Bahn sehr oft Verblendziegel eingesetzt? Versuch Antwort 1, weil gerade in der Gründerzeit das Schienennetz stark erweitert wurde und damit auch neue oder vergrößerte Bahnhöfe entstanden. Antwortversuch 2, weil, wenn ein Schienennetz vorhanden war, auch der Materialtransport von nicht am Ort vorhandenem Material, hier Verblendziegel, günstig und billig war. Und Antwortversuch 3, weil durch die Erfindung des Ringofens und der Ziegelpresse (Mitte 19. Jh.) günstigere technische Bedingungen für eine massenhafte Ziegelherstellung gegeben waren.

Für die Fassaden der Lutherkirche (Schilling & Graebner, 1891 / 92) wurden Backsteine im Reichsformat mit klassischem Mauerverband verwendet. Es liegt nahe, dass diese Ziegel von der Serkowitzer Firma F. W. Eisold, die am Bau beteiligt war, hergestellt wurden. Das entspricht etwa den Kirchenfassaden in den Hansestädten im Norden. Davon sind zwei Vertreter von unverputzten, farbigen Ziegelhäusern, die in der Gestaltung etwas moderner wirken, zu unterscheiden, deren Fassaden aus sogenannten Kohlebrandklinkern bestehen. Es sind dies die Villa Mozartstr. 8 (1930/31) und das Fabrik- oder Werkstattgebäude an der Forststraße (1934, vormals wohl AWD). Hier wurden eindeutig echte Klinker und keine Verblendziegel verwendet. Sie sind typisch für die Zeit zwischen den beiden Kriegen.
Wenn diese Thematik beim ersten Lesen etwas für Verwirrung sorgen sollte, bitte ich um Entschuldigung, vielleicht hilft ein zweites Mal Lesen. Ich fürchte, wenn Sie liebe Leserin, lieber Leser, die im Artikel genannten Beispiele von Klinker- oder Verblendziegelhäusern als Spaziergang gestalten wollen, werden wohl zwei oder drei Spaziergänge praktikabler sein als nur einer. So verstreut wie diese Häuser über das Stadtgebiet auch sind, gehören sie doch, ob sie uns gefallen oder nicht, zur typischen Häusermischung unserer Stadt.
Ich danke den Herren Bialek und Henker, mit denen ich in Sachen Ziegel ein wenig fachsimpeln konnte, herzlich.
Dietrich Lohse